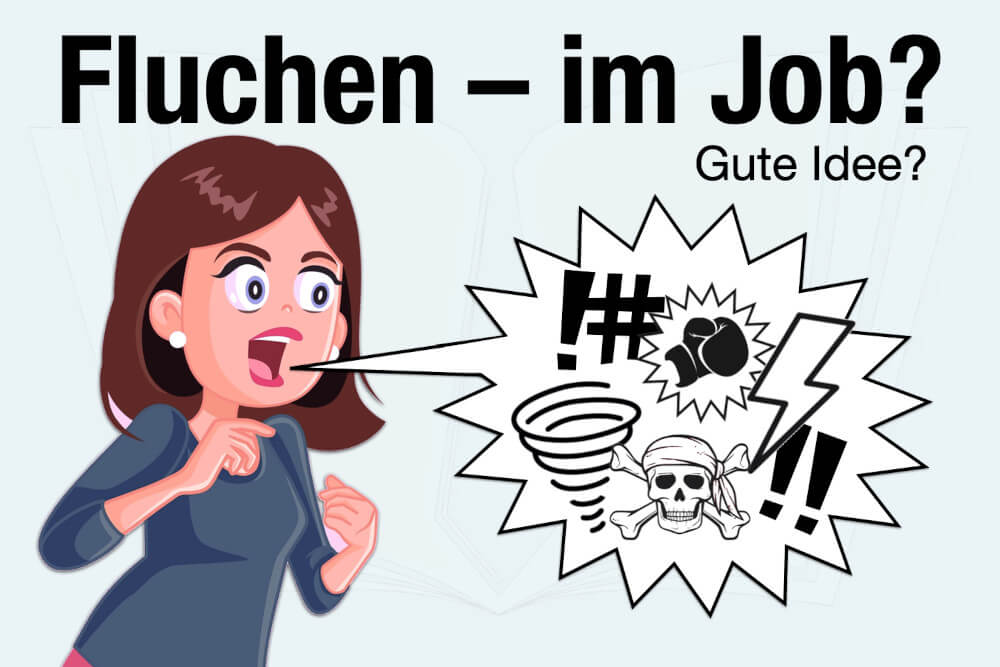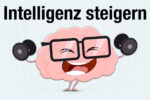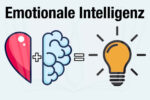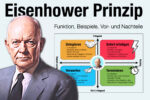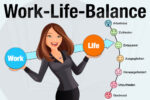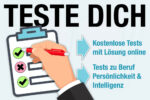Definition: Was zählt als fluchen?
Fluchen bezeichnet laut ausgestoßene Kraftausdrücke sowie Schimpfwörter, die meist im Zustand heftiger emotionaler Erregung ventiliert werden. Wenn Menschen lauthals schimpfen, zetern und vom Leder ziehen, dann meist um ihrem Ärger, Zorn und ihrer Wut Luft zu machen.
Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass Erwachsene bis zu 60 Schimpfwörter (Fachausdruck: Maledicta) am Tag nutzen. Andere behaupten, jedes 200. Wort sei ein Fluch. Genau weiß das natürlich niemand. Wie auch? Die meisten Schimpfwörter und Verwünschungen werden eher im Verborgenen ausgestoßen.
Was ist ein Fluch?
Ein „Fluch“ (auch: Verfluchung) wiederum ist ein negativer Spruch, der ursprünglich auf ritualisierte Weise einer Person oder einem Ort Unheil bringen soll. Meist steckt dahinter eine Strafe bzw. der Wunsch sich zu rächen. In der Antike versuchten Menschen ihre Feinde mit Fluchformeln auszuschalten. Dann schrieben sie ihre bösen Verwünschungen auf kleine Bleittafeln.
Fluchen Beispiele
Aus Gründen der Website-Hygiene wollen wir hier nicht allzu viele Kraftausdrücke und vulgäre Aussprüche wiederholen. Bemerkenswert ist aber, dass Deutsche überwiegend mit Fäkalausdrücken fluchen, während andere Nationen häufiger sexuell aufgeladene Worte nutzen.
In der Öffentlichkeit werden Kraftausdrücke wiederum mehrheitlich durch harmlose Ersatzbegriffe und Pseudo-Schimpfworte verkleidet. Statt also richtig dreckig zu fluchen, sagen die Leute:
- „Verflixt und zugenäht!“
- „Sack Zement!“
- „So ein Mist!“
- „Potz Blitz!“
- „Sch…eibenkleister!“
- „Zur Hölle damit!“
- „WTF – What The Fuck!“
Auch in der Literatur oder Musik kommen Kraftausdrücke und Flüche vor: Goethe ließ zum Beispiel seinen Götz von Berlichingen sagen: „Legg me am Arsch!“ Mozart wiederum komponierte 1782 den weitgehend vergessenen, sechsstimmigen Kanon „Leck mich im Arsch… g’schwindi, g’schwindi“ (Köchelverzeichnis 231).
Flüche sind universell
Verbalinjurien und Schmähungen haben Geschichte. Schon vor mehr als 3000 Jahren meißelten die Ägypter Verwünschungen als Hieroglyphen in ihre Steinwände. Überdies ist Fluchen es ein globales Phänomen: Die Kraftausdrücke variieren zwar von Kultur zu Kultur – als Mittel zum Frustabbau werden sie aber weltweit geschätzt (siehe auch: Diss Sprüche).
Warum ist Fluchen gut und gesund?
„Was lange gärt, wird endlich Wut“, sinnierte einst der Aphoristiker Hanns-Hermann Kersten. Das stimmt. Wahr ist auch, dass Wut, wenn man sie in Maßen rauslässt, gut tut und gesund ist. Zu dem Thema gibt es inzwischen einige Studien deren Ergebnis manchen überraschen dürfte:
Fluchen senkt Stress und Angst
Kaum zu glauben: Beim Fluchen stößt der Körper Glückshormone aus. Diese Endorphine senken den Stress und lassen das Wettern gegen Widrigkeiten wie einen Kurzurlaub wirken. US-Forscher fanden sogar heraus, dass unser Gehirn Schimpfwörter in derselben Region des limbischen Systems speichert wie unsere Emotionen. Aus dem Grund erinnern sich zum Beispiel Demenzkranke noch lange an Schimpfwörter.
Fluchen verbessert den Teamgeist
Sich ab und an lautstark Luft machen und den Ärger nicht runterschlucken, hat einen positiven Effekt auf den Teamgeist. Das sagt der britische Wissenschaftler Yehuda Baruch von der Universität in Norwich. Wenn die Kraftausdrücke nicht beleidigend genutzt werden, bilden sie „Schlüsselverbindung“ zwischen Mitarbeitern und fördern deren Motivation, Solidarität und Wir-Gefühl, Motto: „Wir sitzen alle in demselben Scheiß-Boot!“
Fluchen lindert Schmerzen
Emotionale Eruptionen können schmerzlindernd wirken, fanden Forscher der britischen Keele Universität heraus. Sie ließen Probanden ihre Hand so lange wie möglich in eiskaltes Wasser tauchen. Dazu durften die Leidgeprüften entweder fluchen oder ein neutrales Wort wie „eckig“ oder „hölzern“ ausrufen. Ergebnis: Wer wie ein Seemann schimpfen durfte, hatte eine deutlich höhere Schmerztoleranz und hielt die Hand länger ins Eiswasser. Die Wissenschaftler vermuten, dass das Fluchen die Verbindung zwischen der Angst vor dem Schmerz und dem Schmerzgefühl unterbricht.
Kraftausdrücke wirken kompetent
Das gilt jedoch nur für Männer und nur, wenn diese das Fluchen dosieren. Das sagen Studien der US-Psychologen Victoria Brescoll und Eric Luis Uhlmann. Dazu zeigten sie Probanden Videos von Vorstellungsgesprächen, anschließend sollten diese die Bewerber bewerten. Überraschung: Zeigten die männlichen Bewerber Wut, wurden sie als kompetent und führungsstark wahrgenommen. Bei den Frauen war es genau umgekehrt: Sie galten daraufhin als emotional und für Führungsaufgaben ungeeignet.
Flüche steigern Wahlchancen
Laut italienischen Studien wirken Politiker, die ab und zu vom Leder ziehen, glaubwürdiger und werden eher gewählt. Die Begründung: Ihr Fluchen suggeriert den Wählerinnen und Wählern, dass auch sie intensive Emotionen haben – und das lässt sie ehrlicher und authentischer aussehen.
Fluchen macht kreativ
Die starken Emotionen hinter dem Fluchen regen unsere Sinne an. Wenn auch weiterhin unklar ist, warum Menschen überhaupt fluchen, entwickeln sie laut einer britischen Studie dabei regelmäßig kreative und blumige Begriffe sowie neue Ausdrücke.
Fluchen im Job macht einsam
Bevor Sie jetzt meinen, dies wird ein ungefiltertes Plädoyer für emotionale Ausbrüche… Ist es nicht! Die unschönen Kraftausdrücke haben auch eine Schattenseite: Wer häufig wutschnaubt und sich über eigentlich Unwichtiges aufregt, gilt bei Kollegen bald als Choleriker. Und die sind unsympathisch und deshalb bald einsam. Chronische Flucher riskieren sogar depressiv zu werden, warnt die US-Psychologin Megan Robbins aufgrund ihrer Studien.
Im Job die Beherrschung zu verlieren, ist gefährlich. Kunden schätzen Schimpf und Schande gar nicht und reagieren schon mal verstört oder mit Rückzug – Chefs genauso: Jähzornige Mitarbeiter, die wiederholt herumpöbeln, Türen schlagen oder Büroutensilien beschädigen, riskieren eine Abmahnung und im Wiederholungsfall die verhaltensbedingte Kündigung wegen Störung des Betriebsfriedens.
Unterschiede von Wut, Zorn und Ärger
Die meisten Menschen verwenden die Begriffe Wut, Ärger und Zorn synonym. Psychologen machen hier aber einen Unterschied:
- Ärger hat den geringsten Erregungszustand und geht genauso schnell vorbei, wie er kommt. Meist geht es dabei um Lappalien.
- Wut ist wesentlich heftiger: Wer wütet, verliert die Selbstbeherrschung und zerstört oft blindlings – verbal oder physisch.
- Zorn entsteht wiederum, wenn uns das Ärgernis nicht selbst betrifft, sondern etwas Übergreifendes. Zorn ist daher distanzierter als Ärger oder Wut.
Wie kann ich meinen Ärger besser kontrollieren?
Zu viel Wut tut nicht gut. Oder wie Paracelsus sagen würde: „Die Dosis macht das Gift.“ Zusammen mit dem verbalen Sündenfall werden regelmäßig Hormone wie Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet – und die steigern Blutfett- sowie Zuckerwerte. Wer chronisch Rot sieht, lebt mit einem deutlich erhöhten Risiko, eines Tages einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden.
Gefühle sind Entscheidungssache. Auch die ganz starken. Aufkommende Wut lässt sich kontrollieren und damit einen kühlen Kopf bewahren. Das ist eine Frage des Tatwillens und des Trainings. Ärgerkontrolle (englisch: anger control) heißt das im Fachjargon. Damit ist nicht das Herunterschlucken gemeint – das sorgt für Magengeschwüre. Vielmehr geht es dabei um das bewusste Erleben und Kanalisieren der negativen Gefühle. Das gelingt zum Beispiel so:
-
Durchatmen
Wenn das Blut kocht und Sie am liebsten fluchen würden, sollten Sie erstmal tief durchatmen und bis 10 zählen. In extremen Fällen auch bis 50. Atmen Sie nach der 4-6-8-Methode: Langsam und tief einatmen, bis 4 zählen, die Luft anhalten und bis 6 zählen, langsam durch den Mund ausatmen und bis 8 zählen. Das Ganze wiederholen Sie mindestens fünf Mal. Mit der Übung können Sie Ärger genauso wegatmen wie Stress.
-
Analysieren
Wenn Sie spüren, wie der Ärger anschwillt, nehmen Sie gedanklich Abstand und fragen Sie sich, was Sie so auf die Palme treibt?! Jeder Ärger beginnt im Kopf – dort kann er auch enden. Mit dem Perspektivwechsel verlassen Sie den Tunnelblick und relativieren den Auslöser. Womöglich steckt hinter der teuflischen Gemeinheit bloß Schusseligkeit.
-
Schweigen
Der Punkt kann nicht stark genug betont werden: Solange Sie vor Wut kochen, sollten Sie die Klappe halten und schweigen. Schon im eigenen Interesse! Zorn und eine lose Zunge können zum Bumerang werden. Das gilt auch für den Umgang mit Wüterichen: „Mit einem Vulkan kann man nicht reden!“
-
Überhören
Es ist ein Zeichen von emotionaler Reife und menschlicher Größe, wenn Sie nicht jeden Fehdehandschuh aufheben. So manches Ärgernis lässt sich aus der Welt schaffen, indem Sie auf einem Ohr taub bleiben.
-
Einordnen
Denken Sie langfristig: Rache, schimpfen und fluchen sind vielleicht der erste Impuls. Doch haben sie noch nie ein Unrecht gut gemacht, sondern eher verschlimmert. „Wenn die Wut wächst, denke an die Konsequenzen“, mahnte schon Konfuzius. Weise! Wenn Sie den Blick auf die Zukunft und Konsequenzen richten, werden Sie schnell erkennen, welche Reaktion die beste ist.
Was andere dazu gelesen haben