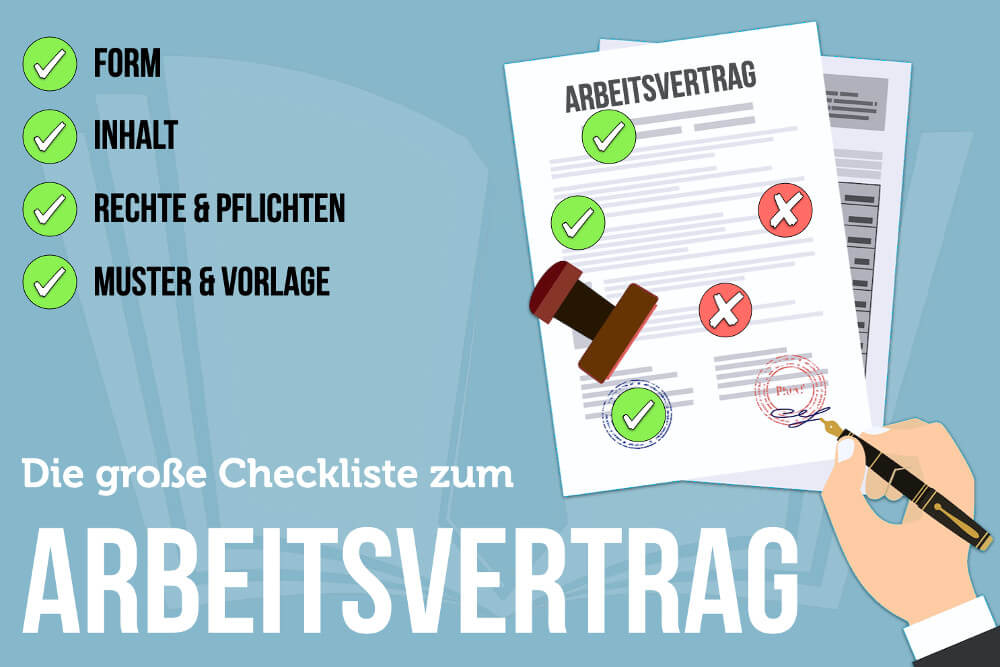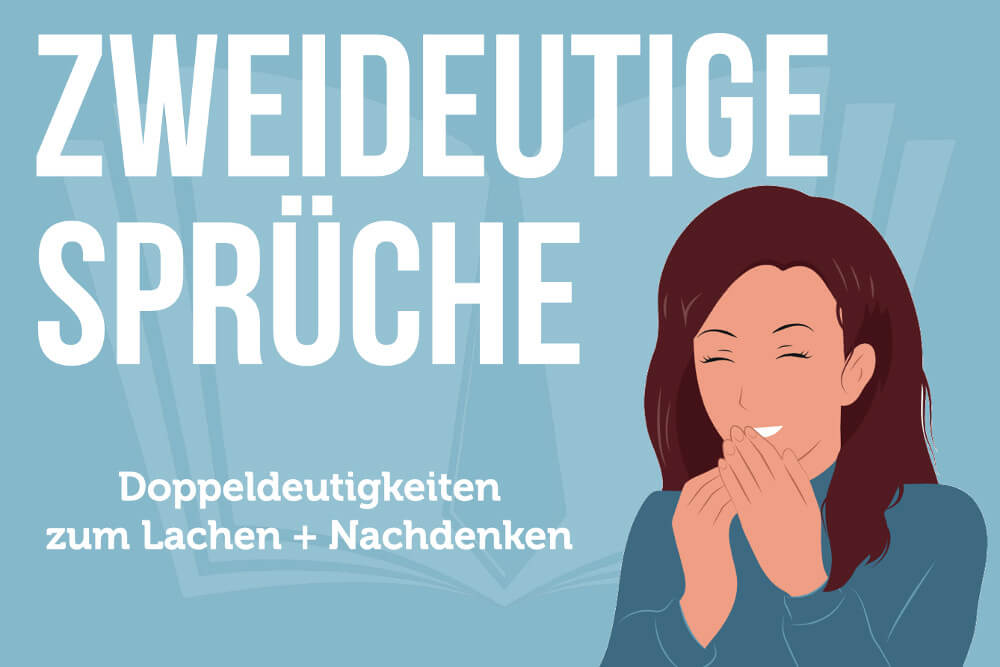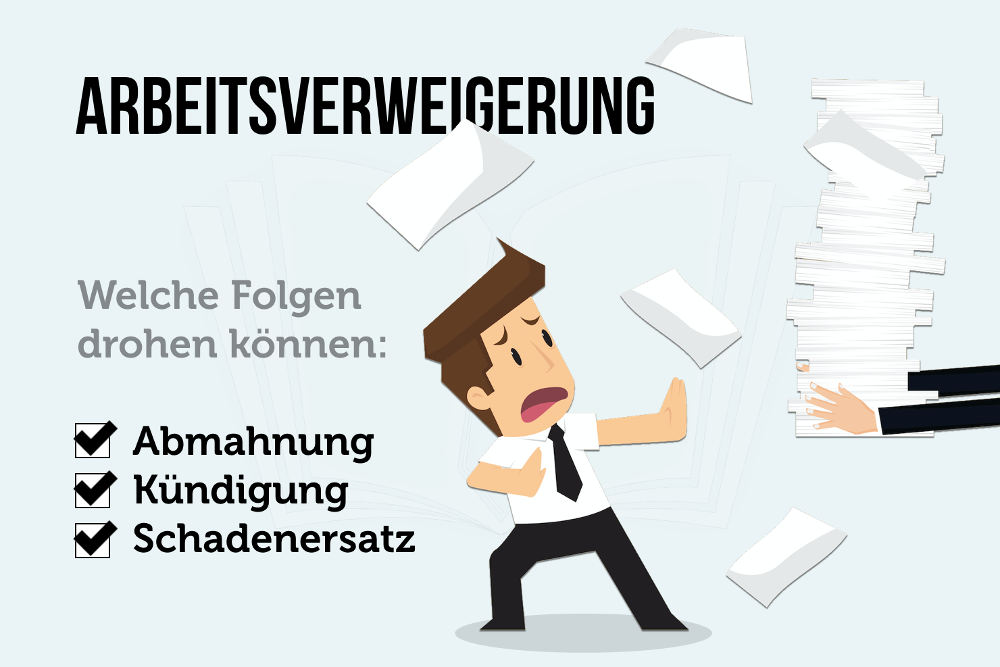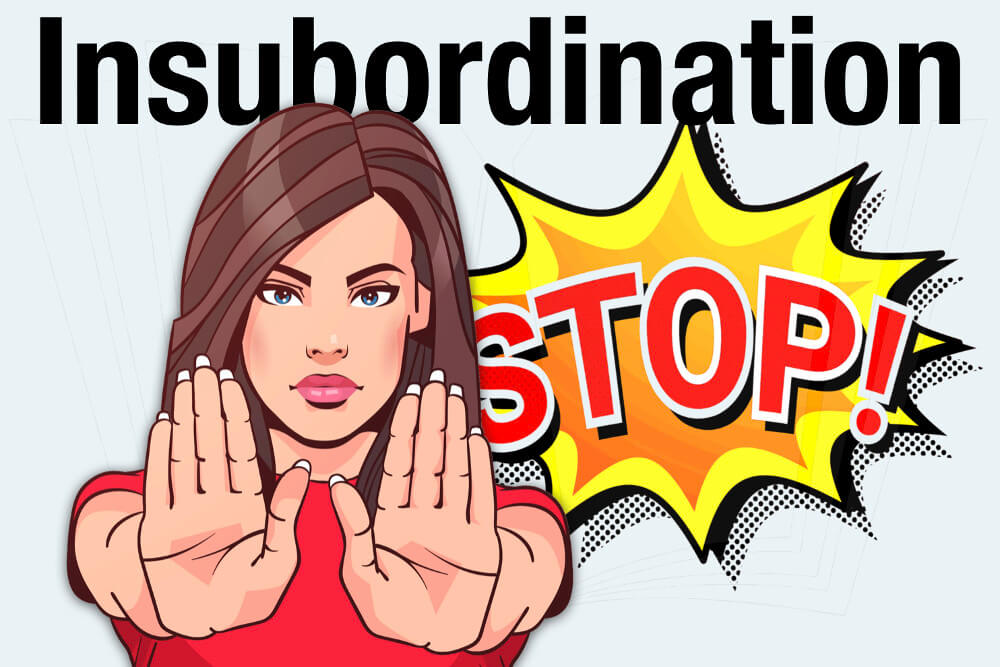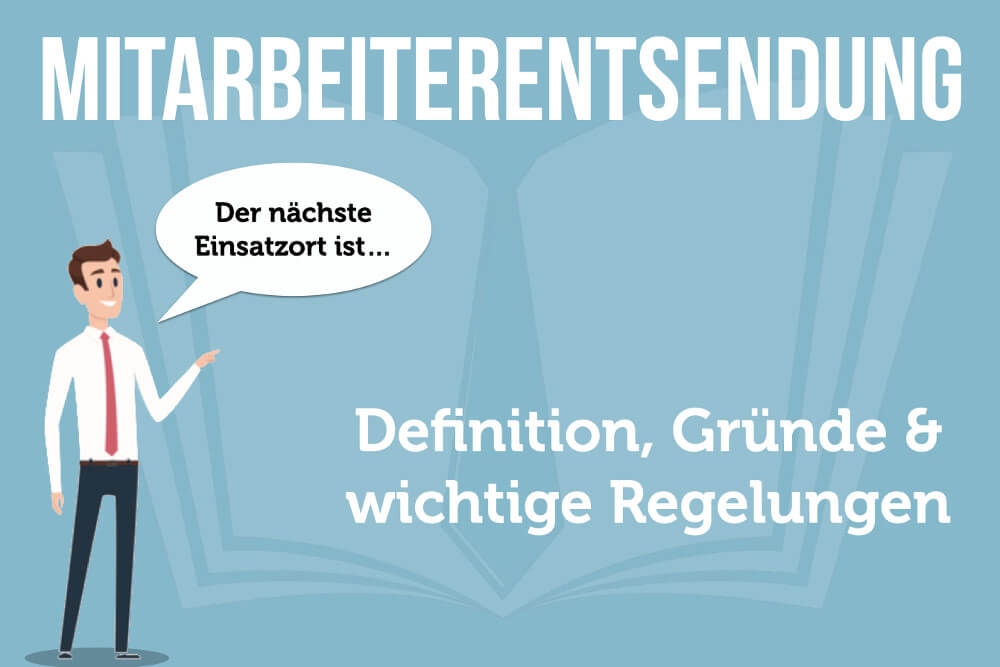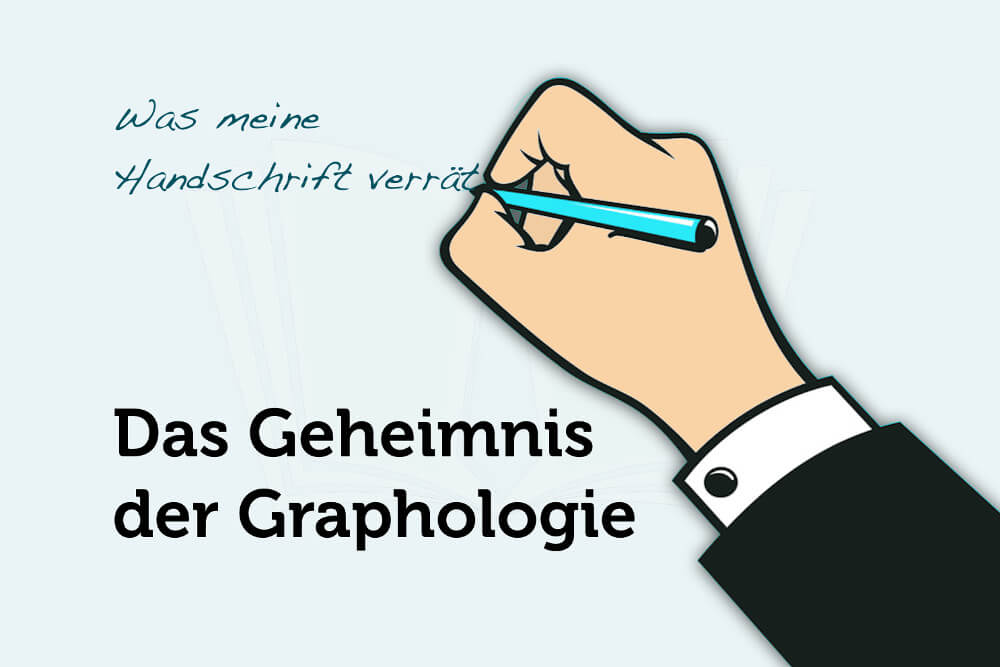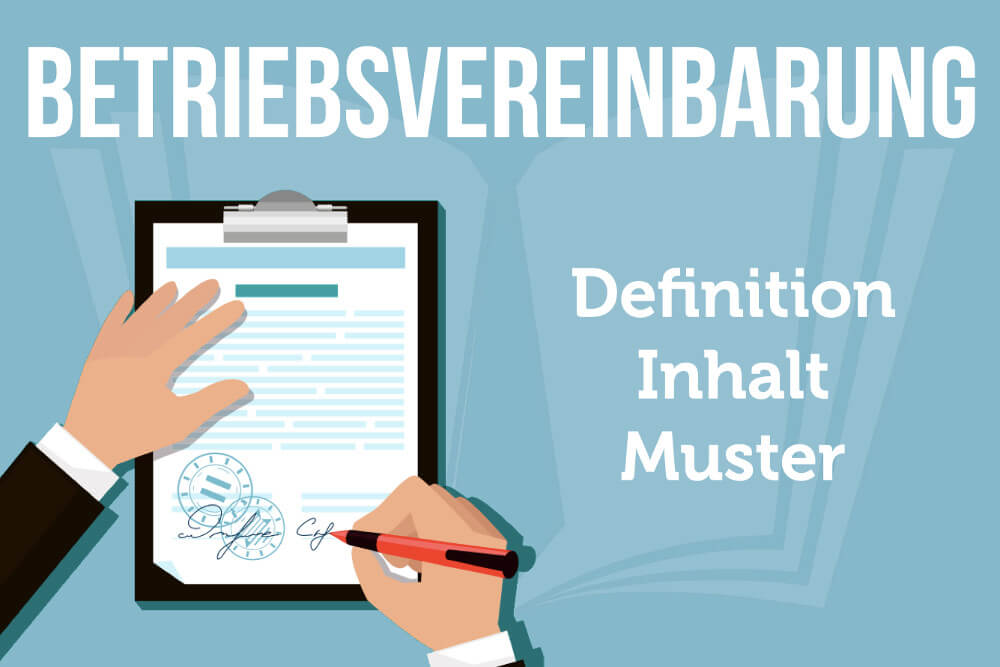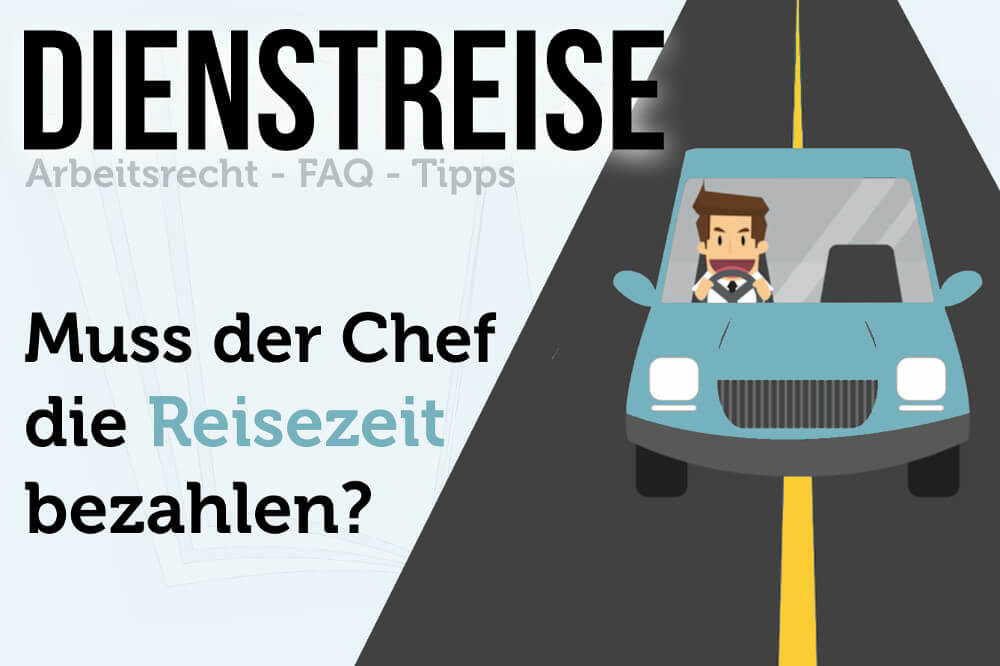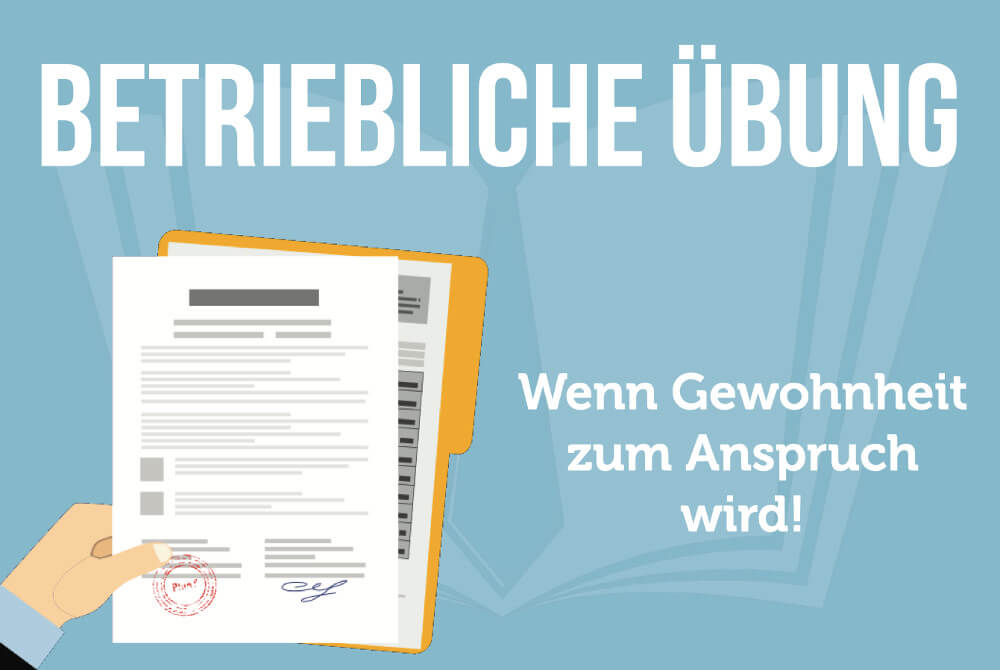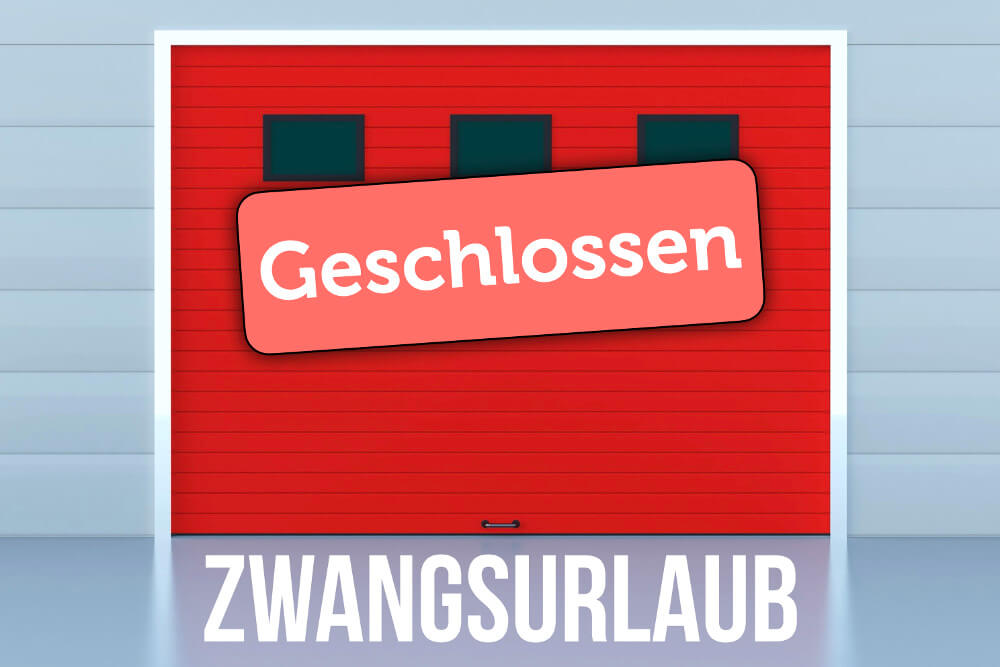Definition: Was ist das Direktionsrecht
Das Direktionsrecht (auch Weisungsrecht genannt) bezeichnet das Recht des Arbeitgebers, seinem Mitarbeiter Anordnungen (Weisungen) zu erteilen. Es erlaubt dem Chef Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung seiner Arbeitnehmer genauer zu bestimmen. Mitarbeiter können demnach so eingesetzt werden, wie es die betrieblichen Umstände erfordern. Grundlage für das Direktionsrecht ist der Arbeitsvertrag, weiter geregelt ist es in § 106 der Gewerbeordnung und § 315 BGB.
Durch das Direktionsrecht müssen Arbeitnehmer auch Aufgaben übernehmen, die nicht eindeutig im Vertrag geregelt sind. Mit der Unterschrift stimmen Mitarbeiter somit nicht nur den ausgehandelten Bedingungen und Pflichten beider Parteien zu, sondern unterliegen auch dem Direktionsrecht des Arbeitgebers.
Allerdings ist dieses nicht unbegrenzt. Der Arbeitnehmerschutz in Deutschland ist besonders groß. Willkürliche Anweisungen sind nicht erlaubt, der Arbeitgeber muss nach billigem Ermessen handeln. Heißt: Es muss eine gerechte und angemessene Anwendung des Weisungsrechts gewährleistet sein.
Beispiele: Diese Bereiche umfasst das Direktionsrecht
Das Direktionsrecht ist also kein Herrschaftsinstrument, mit dem Arbeitgeber über Mitarbeiter frei verfügen können. Aber was umfasst das Direktionsrecht und was darf der Chef durch Weisungen anordnen? Die folgenden Bereiche fallen unter das Direktionsrecht:
Arbeitszeit
Arbeitszeiten sind Gegenstand von Arbeitsverträgen, Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen. Innerhalb dieser Vorgaben darf der Arbeitgeber Gebrauch vom Direktionsrecht machen, indem er Anfang und Ende der täglichen Arbeitszeit, Arbeitsschichten und Pausenzeiten festlegt. Falls vorhanden hat der Betriebsrat jedoch ein Mitbestimmungsrecht, das Direktionsrecht ist hier also nicht komplett frei.
Zu Überstunden ist ein Arbeitnehmer dann verpflichtet, wenn im Arbeitsvertrag eine Überstundenklausel existiert. Anderenfalls sind Überstunden nur dann zu leisten, wenn in absoluten Notfällen im Rahmen der Treuepflicht Mehrarbeit erforderlich ist.
Arbeitsort
Meist wird ein Mitarbeiter an einem bestimmten Arbeitsort eingesetzt werden. Das Direktionsrecht erlaubt jedoch den Einsatz an einem anderen Arbeitsplatz oder einer anderen Betriebsstätte, wenn beispielsweise in einer anderen Filiale ausgeholfen werden muss. Existiert kein fester Arbeitsort – etwa in der Reinigungsbranche – darf der Arbeitnehmer innerhalb des räumlichen Einzugsbereiches frei eingesetzt werden.
Das Direktionsrecht erlaubt jedoch keinen Einsatz im Ausland oder eine Versetzung, wenn der Mitarbeiter den neuen Arbeitsort nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten erreichen könnte. Der Chef darf Sie nicht einfach an einen mehrere hundert Kilometer entfernten Arbeitsort schicken. Dabei muss auch die familiäre und private Situation des Mitarbeiters berücksichtigt werden. Arbeitgeber müssen prüfen, ob andere Mitarbeiter für eine Versetzung eher infrage kommen.
Arbeitsinhalt
Hier gilt: Je konkreter die Angaben im Arbeitsvertrag sind, desto enger die Grenzen des Direktionsrechts. Wurde im Vertrag lediglich ein bestimmter Bereich vereinbart, kann der Mitarbeiter durch das Weisungsrecht zahlreiche Aufgaben innerhalb dieses Bereiches zugewiesen bekommen. Beispielsweise kann ein „Verkäufer“ in diversen Abteilungen des Modehauses eingesetzt werden. Steht im Vertrag hingegen explizit „Verkäufer für Herrenmode“, kann es schwieriger sein, den Mitarbeiter in die Damen oder Kinderabteilung zu beordern.
Dabei darf jedoch keine minderwertige Tätigkeit zugewiesen werden. Ein Programmierer kann im Rahmen des Weisungsrechts nicht zur Reinigungskraft gemacht werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Gehalt weitergezahlt wird.
Ordnung und Verhalten
Teil des Direktionsrechts sind außerdem Anweisungen zur Ordnung und Verhalten im Betrieb (gemäß § 106 Gewerbeordnung). Dazu zählt beispielsweise ein bestimmter Dresscode in Form von Arbeitskleidung. Banken oder auch Juweliere schreiben oft ein seriöses Erscheinungsbild mit Anzug oder Kostüm vor. Durch sein Weisungsrecht verbietet der Arbeitgeber das Tragen von beispielsweise Jeans und T-Shirt beim Kundenkontakt.
Grenzen des Weisungsrechts
Das Weisungsrecht des Arbeitgebers hat klare Grenzen. Mitarbeiter müssen nicht jeder Anweisung folgen und können sich im Zweifelsfall widersetzen. Das gilt besonders in diesen Fällen:
-
Weisung verstößt gegen Gesetze
Natürlich müssen Sie keine Anweisungen umsetzen, wenn Sie dafür gegen bestehende gesetzliche Verbote verstoßen oder sittenwidrig handeln müssten (§ 138 BGB). Kein Chef darf durch sein Direktionsrecht verlangen, dass Sie sich strafbar machen.
-
Arbeits- oder Tarifvertrag regeln etwas anderes
Zwar hat der Arbeitgeber das Direktionsrecht, andere Vereinbarungen gehen aber vor – insbesondere der Arbeitsvertrag, ein für das Arbeitsverhältnis gültiger Tarifvertrag oder bestehende Betriebsvereinbarungen.
-
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats
In Unternehmen mit Betriebsrat kommt in einigen Bereichen des Direktionsrechts das Mitbestimmungsrecht zum Tragen. Gerade im Hinblick auf entscheidende Weisungen wie Versetzungen muss die vorherige Zustimmung des Betriebsrates eingeholt werden (§ 99 Betriebsverfassungsgesetz).
-
Unbillige Weisungen
Bei der Ausübung des Direktionsrechts muss der Arbeitgeber nach billigem Ermessen handeln und dabei die individuellen Umstände und die Interessen des Mitarbeiters berücksichtigen. Tut er das nicht, müssen Sie solch unbilligen Weisungen nicht nachkommen.
Möglichkeiten für Arbeitnehmer
Solange die Anweisungen des Chefs vom Direktionsrecht gedeckt sind, ist ihnen Folge zu leisten – anderenfalls riskieren Sie eine Abmahnung oder sogar Kündigung. Was aber, wenn eine unrechtmäßige Weisung gegeben wird? Hier fürchten Arbeitnehmer negative Konsequenzen, wenn sie sich widersetzen.
Grundsätzlich gilt: Unrechtmäßigen Anweisungen müssen Sie nicht nachkommen. In einem solchen Fall haben Sie das Recht, Ihre Arbeit zu verweigern und die Anweisung nicht umzusetzen. Eine solche Weigerung kann auch nicht als Kündigungsgrund von Seiten des Arbeitgebers genutzt werden.
Allerdings sollten Sie sich zu 100 Prozent sicher sein, dass die Weisung nicht vom Direktionsrecht gedeckt ist. Falls doch, drohen mindestens eine Abmahnung, möglicherweise aber sogar die fristlose Kündigung.
So sichern Sie sich ab
Wenn Sie dieses Risiko nicht eingehen wollen, sollten Sie sich im Vorfeld absichern. Eine erste Möglichkeit: Reichen Sie Beschwere gegen die Weisung ein (gemäß § 84 BetrVG). Das können Sie beim nächsthöheren Vorgesetzten oder beim Betriebsrat tun.
Sollten Sie sich weigern wollen, kann es sinnvoll sein, sich vorher juristisch beraten und absichern zu lassen. Ein Fachanwalt für Arbeitsrecht kann besser beurteilen, ob das Direktionsrecht überschritten wird. Im Zweifelsfall muss am Ende ein Arbeitsgericht entscheiden – das sollte aber nur der letzte Weg sein.
Was andere Leser dazu gelesen haben
- Arbeitnehmerrechte: Bedeutung und Liste Ihrer Rechte
- Arbeitsrecht: Die 60 wichtigsten Rechte für Arbeitnehmer
- Arbeitskleidung: Was darf der Chef vorschreiben?
- Gehaltskürzung: Wegen schlechter Leistung möglich?
- Fürsorgepflicht Arbeitgeber: Schutzpflicht für Arbeitnehmer