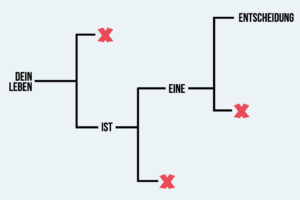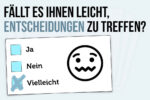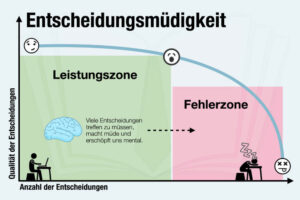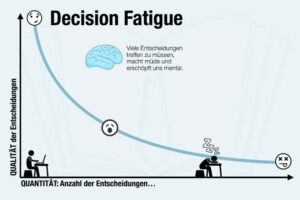Definition: Was ist Wahlblindheit?
Wahlblindheit (Englisch: choice blindness) bezeichnet ein psychologisches Phänomen, bei dem Menschen nicht bemerken, wenn ihre Wahl durch äußere Faktoren manipuliert wurde – und die „falsche“ Entscheidung anschließend trotzdem noch rational verteidigen.
Sie zeigt, dass viele rationale Rechtfertigungen für Entscheidungen oft nachträglich konstruiert werden, statt einen tatsächlich ursächlichen Wahlfehler zuzugeben (siehe auch: Hindsight Bias).
Wahlblindheit Ursprung & Experiment
Die sogenannte Wahlblindheit wurde erstmals 2005 von Petter Johansson und Lars Hall an der Universität Lund beschrieben: In Experimenten sollten sich Probanden für das attraktivere von zwei Gesichtern entscheiden. Die Forscher tauschten jedoch unbemerkt die gewählte Karte aus. Die Mehrheit der Teilnehmer bemerkte den Tausch überhaupt nicht – begründete aber die Wahl für das untergeschobene Gesicht, als wäre es tatsächlich ihre eigene Entscheidung gewesen.
Merkmale der Wahlblindheit:
- Menschen sind sich ihrer Entscheidungen oft nicht bewusst und nehmen Manipulationen selten wahr.
- Gleichzeitig neigen sie dazu, selbst manipulierte Entscheidungen nachträglich zu verteidigen und rational zu begründen.
- Durch die psychologische Wahlblindheit entsteht ein Rechtfertigungsdruck und kognitiver Abwehrmechanismus.
Das Phänomen zeigt sich sowohl bei einfachen Präferenzen (z.B. Geschmack, Attraktivität) als auch bei komplexen Themen wie der Partnerwahl oder politischen Wahlen.
Choice Blindness Beispiel: Ich habe mich nicht geirrt!
Zur Wahlblindheit bzw. Choice Blindness gibt es inzwischen zahlreiche Experimente, die den psychologischen Effekt (siehe: Bias) bestätigen. Schon der Gedanke, die Wahl später rechtfertigen zu müssen, reicht oft aus, um die Entscheidung zu beeinflussen.
Der Verhaltensökonom Aner Sela von der Universität Florida setzte Probanden zum Beispiel verschiedene Eiscremesorten vor – darunter Klassiker wie Schokolade und Vanille, aber auch Sorbets mit Früchten und fettreduzierte Diätsorten. Mussten die Teilnehmer ihre Wahl jedoch begründen, wählten sie automatisch die gesunden Optionen.
Kognitive Dissonanz: Wahlblindheit fördert Rechtfertigungszwang
Was hinter der Wahlblindheit wirkt und zum Rechtfertigungszwang wird, ist eine typische Form der kognitiven Dissonanz. Wir alle wünschen uns im Kern eine widerspruchsfreie Welt: Unstimmigkeiten und Ungewissheit sind zutiefst unangenehm und nur schwer zu ertragen.
Dieser negative Gefühlszustand entsteht jedoch regelmäßig – zum Beispiel bei unvereinbaren Wahrnehmungen wie optischen Täuschungen oder widersprüchlichen Meinungen in Diskussionen oder Kommentaren im Internet (siehe: Ambiguitätstoleranz).
Weil nur wenige aushalten, halten sie lieber dagegen. Die Folge: eine typische Vorwärtsverteidigung und Flucht nach vorn. Beobachten lässt sich das etwa bei Rauchern: Natürlich weiß jeder, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Trotzdem kontern viele dann, das Leben sei generell gefährlich und die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, sei längst nicht so hoch, wie alle behaupten. Und überhaupt: „Was ist mit Helmut Schmidt?“ Der rauchte seit zwoundtrölfzig Jahren Kette und starb auch nicht an Lungenkrebs!
Ähnlich ist es mit der Wahlblindheit im Job: Viele stecken in einer Karrieresackgasse fest oder sind unglücklich im Job. Aber etwas ändern oder endlich den Job wechseln? Stattdessen wird eine Ausrede, ein Grund nach dem anderen gefunden – Hauptsache die aktuelle Passivität sieht wieder richtig aus…
Hinter Wahlblindheit steckt der Wunsch nach Absolution
Neben dem gefühlten Zwang, sich rechtfertigen zu „müssen“, gibt es noch das Gefühl, sich unbedingt für seine Entscheidung rechtfertigen zu „wollen“. Also das Bedürfnis, die eigene Entscheidung vor anderen so zu begründen, dass sie richtig aussieht und wir von unseren Mitmenschen eine Art Absolution erhalten.
All die Rechtfertigungen, mit denen wir eine Wahl ausschmücken, verfolgen doch nur ein Ziel: die eigene Entscheidung bitte bestätigt zu bekommen! Die ganze Aktion ist nichts weiter als eine Beruhigungspille für das eigene schlechte Gewissen.
Meist spielen dabei drei Motive eine entscheidende Rolle:
-
Der Wunsch nach Unterstützung
Manche Entscheidungen haben schwerwiegende Konsequenzen. Wer seinen Job kündigt und wechselt, geht in eine ungewisse Zukunft. Im Vorfeld alleine abzuschätzen, ob die Wahl tatsächlich richtig ist, ist für viele eine nervliche Zerreißprobe. Gut, wenn uns dann jemand sagt: „Gute Wahl! Das würde ich auch so machen!“ Natürlich weiß auch diese Person nicht, was die Zukunft bringt. Aber Sie hat unsere Wahl bewertet, bestätigt und gutgeheißen – und sich damit zumindest moralisch verbündet. Manche nutzen das jedoch auch, um bei Rückschlägen Schuldige zu finden, Motto: „Du hast mir doch damals dazu geraten!“ Das ist zwar unzulässig, aber eine Wahlerleichterung in der Gegenwart.
-
Die Angst vor den Konsequenzen
Der Zuspruch, den man erhält, macht es einfacher, sich auf mögliche Folgen einzustellen. Im Hinterkopf manifestiert sich der Gedanke: „Die anderen wissen, warum ich mich so entschieden habe, können es nachvollziehen und stehen hinter der Entscheidung!“ Wir rechtfertigen uns also auch deshalb, um andere auf unsere Seite zu bringen und nicht auf uns allein gestellt zu sein. Mehr noch: Wir müssen uns dann auch nicht mehr rechtfertigen – das haben wir schließlich schon im Vorfeld getan!
-
Der Versuch, ein besseres Selbstbild zu erzeugen
Auch wenn Rechtfertigungen häufig der eigenen Unsicherheit entspringen – sie helfen dabei, ein positives Selbstbild zu erzeugen. Schließlich können wir uns damit selbst zeigen, dass wir gute Gründe für diese Wahl hatten! Die Botschaft: „Ich habe offensichtlich alles richtig gemacht!“
Möglicherweise falsche Entscheidungen zu rechtfertigen, kann gegensätzliche Folgen haben: Auf der einen Seite beeinflusst es die Wahl von vornherein, nicht unbedingt zum Besseren. Auf der anderen Seite sorgt es dafür, dass wir uns insgesamt mit der getroffenen Entscheidung wohler fühlen und Schadensbegrenzung betreiben.
Was kann ich gegen Wahlblindheit tun?
Ganz oft müssen wir mit Widersprüchen im Leben leben. Eine einfache Lösung dafür gibt es nicht. Gleichzeitig übersehen viele bei der Wahlblindheit, dass auch zwei oder mehr Optionen und Meinungen nebeneinander existieren können. Manche scheinbaren Gegensätze schließen sich überhaupt nicht aus, sondern können sich sogar symbiotisch ergänzen – das eine tun, das andere nicht lassen!
Aus dem engen Korsett des „Entweder-oder“ und Schwarz-Weiß-Denkens wird so ein luftiges „Sowohl-als-auch“.
Kompromisse sind ein gutes Gegenmittel gegen Choice Blindness. Sie müssen auch nicht jedes Mal ein Mittelweg im Sinne einer Fifty-fifty-Lösung sein. Auch ein 80-20-Resultat kann helfen, das Beste aus beiden Optionen zu vereinen und unsere Ansprüche maximal zu befriedigen.
Strategien gegen Wahlblindheit
Schon aus den bisherigen Erkenntnissen lassen sich drei Empfehlungen gegen die Wahlblindheit und für bessere Entscheidungen ableiten:
-
Hören Sie auf, nach dem „richtigen“ Weg zu suchen.
Der Begriff „richtig“ suggeriert bereits, dass es immer eine allgemeingültige Lösung beziehungsweise Entscheidung gäbe. Für die meisten unserer Alltagsentscheidungen trifft das überhaupt nicht zu. „Richtig“ muss eher im Kontext von „für mich richtig“ oder „in diesem Moment richtig“ gesehen werden. Wer das im Hinterkopf behält, dem fällt es leichter, sich von überhöhten Erwartungen zu lösen.
-
Verabschieden Sie sich vom Schwarz-Weiß-Denken.
All die Kategorien – Entweder-oder, Ja-nein, Richtig-falsch – zwingen uns in zweidimensionale Denk- und Entscheidungsstrukturen. Statt verschiedene Optionen als unvereinbare Gegensätze zu begreifen, können Sie diese auch als Teile eines Ganzen betrachten. Dann müssen Sie nicht das eine für das andere aufgeben, sondern sind frei, nach einem Weg zu suchen, um beide Seiten miteinander zu verbinden.
-
Ergänzen Sie Ihre Wahl um die zeitliche Dimension.
Was gerade wichtig und richtig ist, muss es morgen schon nicht mehr sein… Umstände und Konstellationen können sich ändern. Die bessere Entscheidung ist daher häufig jene, die wir langfristig treffen – also mit Blick auf die Zukunft! Dazu kann auch gehören, hier und jetzt noch keine Entscheidung zu fällen. Denn auch das ist wahr: Es gibt immer eine dritte Option – die, noch nicht zu wählen.
Auch das ist eine Entscheidung. Und je bewusster wir diese treffen, desto besser.
Was andere dazu gelesen haben