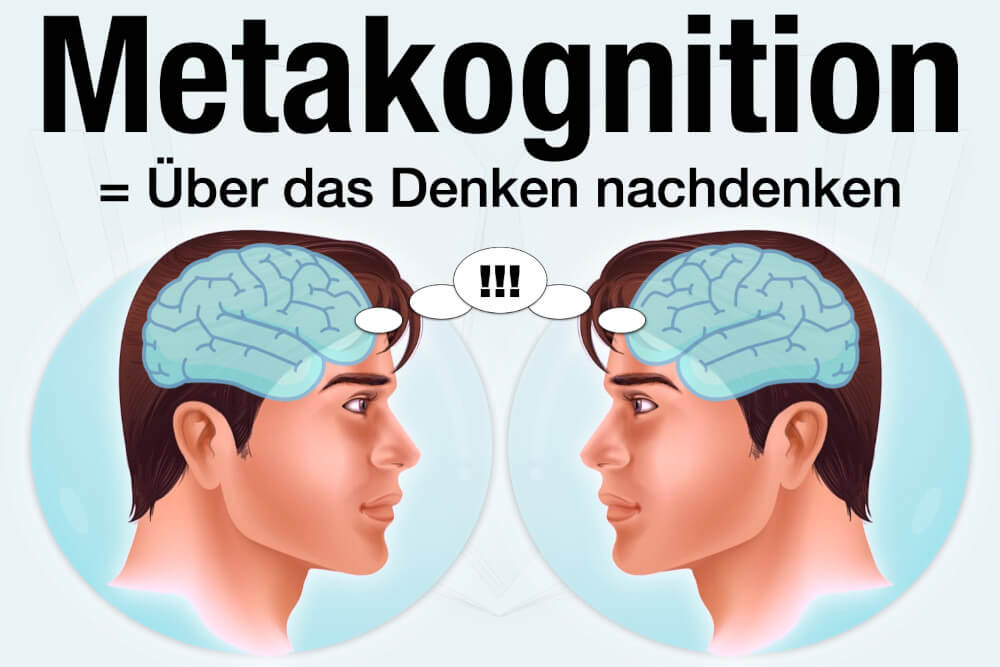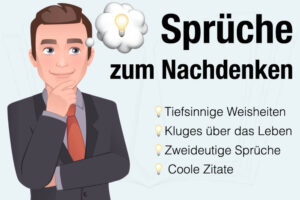Definition: Was ist Metakognition?
Metakognition ist die Fähigkeit, über das eigene Denken und kognitive Prozesse nachzudenken, Entscheidungen zu hinterfragen und diese bewusst zu steuern oder zu optimieren.
Erst durch Metakognition erkennen Sie Ihre Denkprozesse, Denkmuster, das eigene Wissen sowie Unwissen bzw. Denkfehler. Schon die Erkenntnis „Dieser Gedanke belastet mich“ ist Ausdruck von metakognitiven Fähigkeiten.
Der Begriff leitet sich vom Griechischen „Meta“ (= über oder darüber hinaus) und „Kognition“ (= Denken oder Erkennen) ab. Der Fachbegriff wurde erstmals in den 1970er-Jahren von dem Psychologen John H. Flavell geprägt, der die Auffassungsgabe erforschte, die eigenen Denkprozesse zu beobachten und zu steuern.
Metakognition Beispiele: 10 Gedanken
Unsere Gedanken sind ständiger Ausdruck von metakognitiven Fähigkeiten. Hier 10 einfache Beispiele für metakognitives Denken:
- „Ich habe schlechte Laune und sollte positiver denken.“
- „Gehe ich gerade wirklich sinnvoll vor?“
- „Heute kann ich mich nicht richtig konzentrieren.“
- „Ich lerne besonders gut visuell.“
- „Ich dachte, dieser Ansatz würde besser funktionieren.“
- „Das verstehe ich nicht, wenn ich es nicht wiederhole.“
- „Wie kann ich meinen Lernerfolg verbessern?“
- „Wieso belastet mich das gerade?“
- „Was ich gerade versuche, kann gar nicht klappen!“
- „Welche Strategie bringt mich wirklich ans Ziel?“
Metakognition – einfach erklärt
Einfach ausgedrückt ist Metakognition das Denken über das eigene Denken und das Wissen über das eigene Wissen. Durch die Fähigkeit sind sich Menschen der eigenen kognitiven Prozesse (Gedanken, Erinnerungen, Meinungen, Aufmerksamkeit) bewusst und können darüber nachdenken und diese beeinflussen.
Bereiche von Metakognition
Experten differenzieren bei der Metakognition zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Schwerpunkten:
1. Metakognitives Wissen
Megakognitives Wissen ist das Wissen über kognitive Fähigkeiten oder Prozesse – vor allem über die eigene Denkweisen. Dazu gehört ebenfalls das Lernen oder die Problemlösung bei Herausforderungen oder Aufgaben.
Metakognitives Wissen wird nochmal in vier Bereiche unterteilt:
-
Personenbezogenes Wissen
Wissen über die individuellen kognitiven Prozesse, Stärken oder Schwächen – Beispiel: „Ich kann mir Namen schlecht merken.“
-
Aufgabenbezogenes Wissen
Wissen über die Anforderungen unterschiedlicher Aufgaben – Beispiel: „Dieses Problem erfordert vor allem analytisches Denken!“
-
Strategisches Wissen
Wissen zur Beurteilung und Auswahl geeigneter Strategien zur Problemlösung – Beispiel: „Das lerne ich nicht durch Theorie, sondern nur durch praktische Erfahrungen!“
-
Metakognitive Empfindungen
Bewertungen der Schwierigkeit von Aufgaben, die intuitiv während kognitiver Prozesse auftreten – Beispiel: „Das ist ganz schön kompliziert! Ich muss mir das häufiger durchlesen, um es zu verstehen.“
2. Metakognitive Regulation
Metakognitive Regulation ist die Steuerung, Kontrolle und Optimierung der eigenen kognitiven Fähigkeiten und Lernprozesse. Hierbei legen Sie zunächst Ziele fest und planen deren Umsetzung, kontrollieren den Fortschritt und nehmen Änderungen oder notwendige Anpassungen Ihres Verhaltens vor, um es zu erreichen (siehe auch: konvergentes Denken).
Metakognition Beispiele im Alltag
Metakognition ist nicht nur ein theoretischer Ansatz in der Psychologie oder den Neurowissenschaften. Es ist eine zentrale Fähigkeit des menschlichen Denkens, die sich im Alltag in vielen Beispielen zeigt:
-
Selbstreflexion
Sie denken bewusst über Ihre Gedanken oder Entscheidungen nach. Selbstreflexion ist aktive Metakognition, mit der Sie sich selbst besser verstehen und einschätzen.
-
Fehleranalyse
Sie erkennen, wenn Sie einen Fehler gemacht oder eine falsche Beurteilung vorgenommen haben.
-
Problemlösung
Sie verstehen auftretende Probleme oder Aufgaben und finden Strategien, um diese zu lösen. Dabei nutzen Sie vorhandenes Wissen und passen Ihr Vorgehen bei Bedarf an.
-
Priorisierung
Sie beurteilen Aufgaben (oder Themen) nach deren Wichtigkeit und verstehen, aus welchen Gründen etwas zuerst bearbeitet werden muss. So finden Sie eine sinnvolle Reihenfolge.
-
Selbsteinschätzung
Sie kennen Ihre eigenen Stärken, Fähigkeiten und Leistungen. Gleichzeitig verstehen Sie Ihre Grenzen und Dinge, die Sie nicht (gut) können.
Welche Vorteile hat Metakognition?
Metakognition bietet zahlreiche Vorteile, insbesondere für effektives Lernen, die persönliche Entwicklung und psychische Gesundheit. Wesentliche Vorteile sind:
-
Effektiveres Lernen
Durch Metakognition können Lernende ihren Lernprozess eigenständig planen, ihre Lernmethoden anpassen und überwachen sowie ihren Lernerfolg reflektieren. Das führt zu besseren Lernerfolgen und langfristiger Wissensaneignung.
-
Tieferes Verständnis
Metakognition fördert das Nachdenken über das eigene Leben, Lernen und Denken, was hilft, ein tieferes Verständnis seiner Selbst und seines Umfelds zu entwickeln oder neues Wissen mit vorhandenem Wissen zu verknüpfen.
-
Bessere Selbsteinschätzung
Menschen mit metakognitiven Fähigkeiten haben in der Regel ein realistisches Selbstbild und können ebenso Ihre Stärken und Grenzen besser einschätzen oder gezielt daran arbeiten.
-
Gesteigerte Motivation
Das Bewusstsein über die eigenen Fortschritte und die Kontrolle über den eigenen Lernprozess fördern die Motivation und das Durchhaltevermögen.
-
Stärkere Resilienz
Wer ausgeprägte metakognitive Fähigkeiten besitzt, entwickelt zugleich eine gesunde Distanz zu seinen Gefühlen, vermeidet disruptives Grübeln und kann schwierige Situationen klarer bewerten. Das fördert die Anpassungsfähigkeit, die Selbstwirksamkeit und die eigene Resilienz.
-
Stabilere psychische Gesundheit
Metakognitive Fähigkeiten unterstützen zugleich den Umgang mit Stress, Konflikten und allgemeinen Belastungen und helfen zum Beispiel, seinen Fokus bewusst auf positive Dinge zu richten oder besser abzuschalten.
Damit ist Metakognition eine zentrale Kompetenz des menschlichen Bewusstseins, die unser Denken und Handeln permanent verbessert sowie starke positive Auswirkungen auf unser Leben und die Lebensqualität hat.
Metakognition vs. Grübeln – Unterschied
Merkmal |
Metakognition |
Grübeln |
| Definition | Bewusstes Nachdenken über das eigene Denken | Wiederholtes, oft zwanghaftes Nachdenken über Probleme oder negative Erlebnisse |
| Ziel | Steuerung der eigenen Denkprozesse | Versuch, Probleme zu lösen, meist ineffektiv |
| Gegenwart und Zukunft |
Vergangene Ereignisse |
|
| Kontrolle | Bewusst und steuerbar | Oft unkontrollierbar, führt zu Gedankenschleifen |
| Funktion | Verbessert Lernen, Problemlösung, Anpassung | Erhält negative Stimmung und depressive Symptome |
| Psyche | Fördert Resilienz und Selbstwirksamkeit | Kann Sorgen und Angstörungen verstärken |
Diese Gegenüberstellung zeigt, dass Metakognition eine aktive, kontrollierte und adaptive Denkstrategie ist, während Grübeln sich als passives, oft belastendes und dysfunktionales Wiederholen negativer Gedanken äußert.
Metakognition beim Lernen
Besonders wichtig ist Metakognition für effektives Lernen und den bestmöglichen Lernerfolg. Richtig genutzt bringt es Schülern, Azubis und Studenten zahlreiche Vorteile:
-
Eigenständige Planung
Sie können Ihren Lernprozess eigenständig und gezielt planen. Dabei bestimmen Sie die Ziele, klären Lerninhalte, legen Prioritäten fest und kümmern sich um das Zeitmanagement.
-
Effizienteres Lernen
Durch metakognitive Fähigkeiten wählen Sie die besten Lernmethoden aus – zugeschnitten auf Sie selbst und die Themen. Sie verstehen, wie Sie verschiedene Dinge am besten lernen und passen Ihren Lernprozess an.
-
Tieferes Verständnis
Sie denken über die Lerninhalte und das Lernen selbst nach. Die Kombination bringt ein insgesamt tieferes Verständnis, weil Sie nicht nur Neues besser aufnehmen, sondern es mit vorhandenem Wissen verknüpfen.
-
Größere Motivation
Beim Lernen bleibt die Motivation erhalten, weil Sie Fortschritte sehen und eigenständig handeln. Statt nur einen vorgegebenen Lernplan zu verfolgen, bestimmen Sie Ihr eigenes Vorgehen.
-
Genauere Einschätzung
Metakognition verbessert Ihre Selbsteinschätzung. Sie haben ein realistisches und genaues Bild Ihres Wissens – und gestehen sich ein, wo es noch Wissenslücken gibt, die Sie schließen müssen.
4 Lerntypen nach Metakognition
In welchem Ausmaß die Fähigkeit genutzt wird, ist vom Lerntyp abhängig – nicht nach der Art der Informationsaufnahme (visuell, auditiv, kommunikativ oder motorisch), sondern nach Ausprägung der metakognitiven Fähigkeiten.
Harvard-Professor David Perkins unterscheidet dabei 4 verschiedene Lerntypen.
-
Tacit Learner (Impliziter Lerner)
Der Lerntyp ist sich seiner Metakognition nicht bewusst und nutzt sie nicht aktiv. Er hinterfragt Lernmethoden nicht, sondern nutzt diese intuitiv ohne Reflexion.
-
Aware Learner (Bewusster Lerner)
Der bewusste Lerner kennt seine Fähigkeiten. Es fehlen allerdings Methoden zur richtigen Anwendung der Metakognition. Es ist kein zielgerichtetes Lernen und Verbesserungen sind eher Zufall.
-
Strategic Learner (Strategischer Lerner)
Der strategische Lerner kennt und nutzt seine Metakognition, um das Lernziel zu erreichen. Er hat Strategien zur Problemlösung, bewertet Informationen und ordnet seine Gedanken.
-
Reflective Learner (Reflektierender Lerner)
Reflektierende Lerner ergänzen das strategische Vorgehen um kritisches Hinterfragen. Sie entwickeln Lernstrategien und prüfen deren Wirksamkeit. Zeigt der Ansatz keine Effizienz, wird er angepasst und eine andere (bessere) Methode gewählt.
Metakognition verbessert die Noten
Stanford-Studien zeigen: Gezielte Metakognition sorgt für bessere Leistungen. Die Studien-Teilnehmer mussten eine Woche vor der Klausur durch Fragebögen über die anstehende Klausur nachdenken. Sie schätzten Ziele, nützliche Lernmethoden und die Bedeutung der Prüfung ein. Schon durch diese Übung waren die Noten im Schnitt um ein Drittel besser als bei der Kontrollgruppe.
Die Erkenntnis der Forscher: Es ist enorm wichtig, sich Ziele zu setzen und darüber nachzudenken, welche Ressourcen man einsetzt, um diese Ziele besser zu erreichen!
Metakognition trainieren: 3 Tipps
Jeder Mensch besitzt metakognitive Fähigkeiten. Sie sind aber unterschiedlich stark ausgeprägt und werden nicht von allen gleichermaßen genutzt. Wie andere Fähigkeiten können Sie Ihre Metakognition trainieren. Diese drei Tipps helfen dabei:
-
Selbstreflexion
Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Gedanken zu hinterfragen und sich mit Ihren Kognitionen auseinanderzusetzen: Woran denken Sie? Welche Erinnerungen gehen Ihnen durch den Kopf? Was lenkt Ihre Aufmerksamkeit? Beschäftigen Sie sich mit den Gedanken in Ihrem Kopf.
-
Lautes Denken
Ungewohnt, aber effektiv: Sprechen Sie Ihre Gedanken laut aus, um diese leichter greifbar zu machen. Fassen Sie in Worte, was sonst nur gedanklich abläuft. Sagen Sie beim Lernen zum Beispiel laut „Das ist ein wichtiger Aspekt, der mir Schwierigkeiten macht.“
-
Fortschrittskontrolle
Egal, ob Sie im Job ein Projekt bearbeiten oder für eine Prüfung lernen: Kontrollieren Sie Ihren Fortschritt! Dies zwingt Sie zur Metakognition. In regelmäßigen Abständen reflektieren Sie Ihr Vorgehen und passen die weitere Strategie an.
Checkliste für metakognitives Lernen
Sie stecken gerade in einer Lernphase? Dann zeigt unsere Checkliste, wie Sie metakognitiv über die Klausur nachdenken und die Fähigkeit bestmöglich nutzen:
- Identifikation
Welche Teile des Themengebiets sind wichtig und welche weniger? - Einteilung
Wie viel Zeit plane ich für welche Lektion ein? Was schaffe ich in welcher Zeit? - Reihenfolge
In welcher Reihenfolge gehe ich den Inhalt durch? Beginnen Sie zum Beispiel mit dem wichtigsten oder einfachsten Thema. - Methoden
Welche Lernmethoden sind für mich und die Lerninhalte am besten? - Verständnis
Habe ich alles verstanden? Was kann ich tun, um das, was ich nicht verstanden habe, zu verstehen? - Abfrage
Wie prüfe ich meinen Fortschritt und mein Wissen am effektivsten? - Nachbearbeitung
Was habe ich gut und was weniger gut gemacht? Was sollte ich mit Blick auf die nächste Klausur ändern?
Was andere dazu gelesen haben