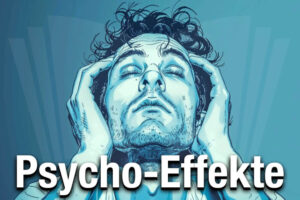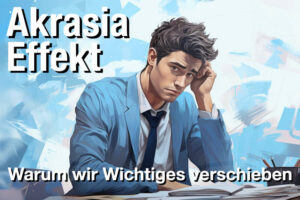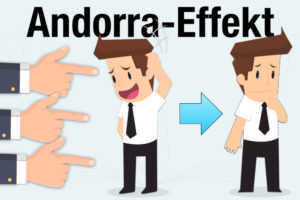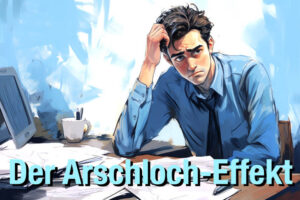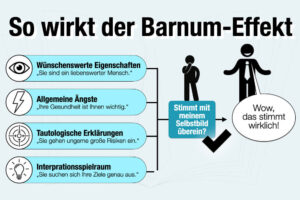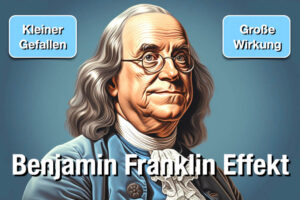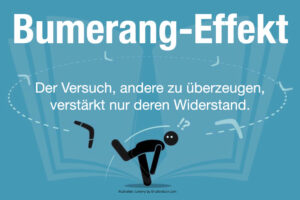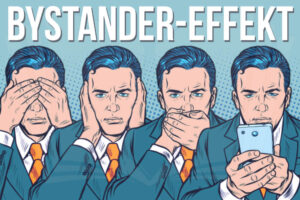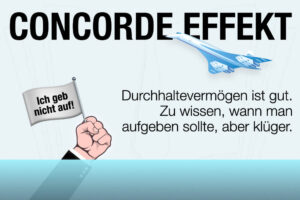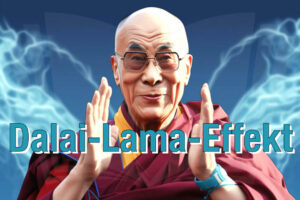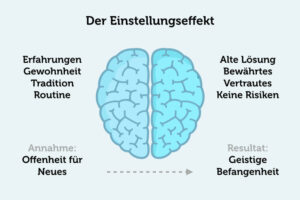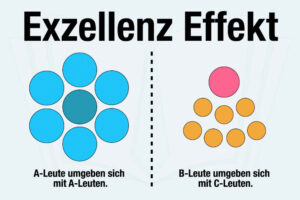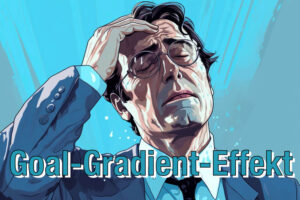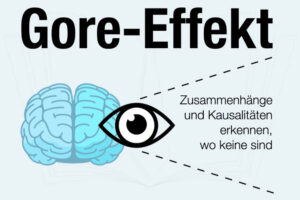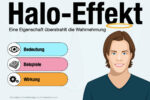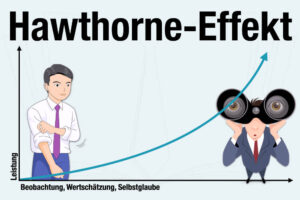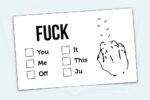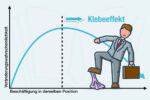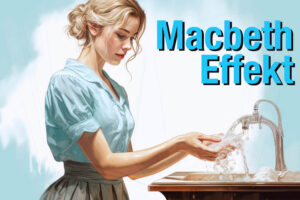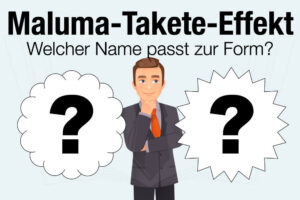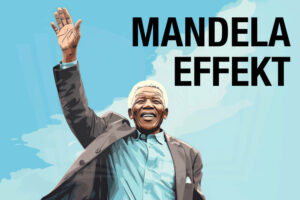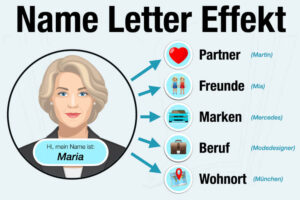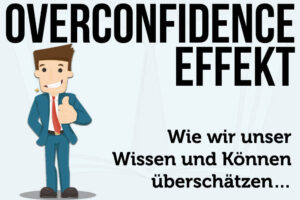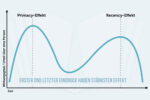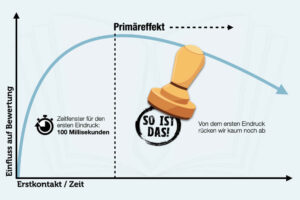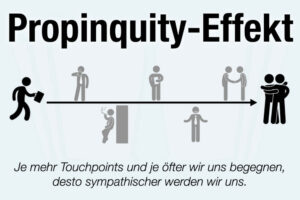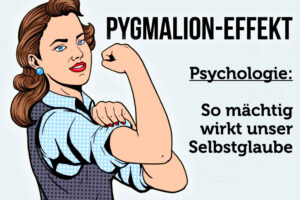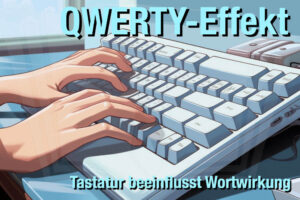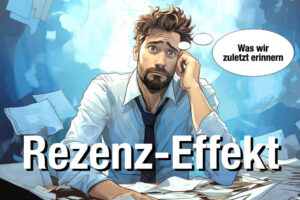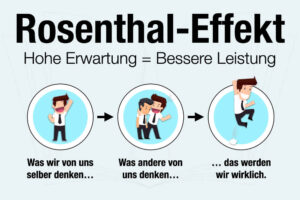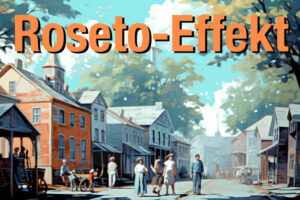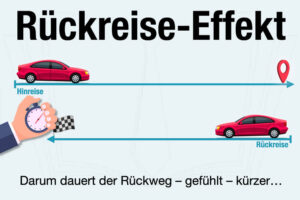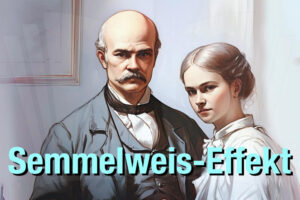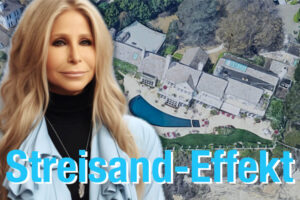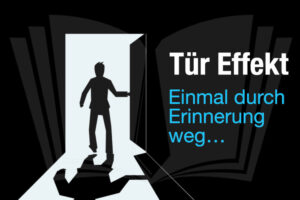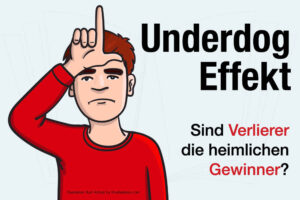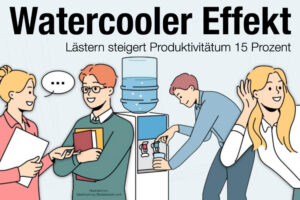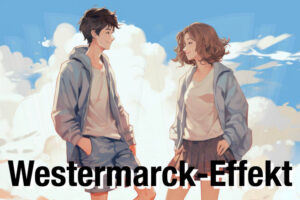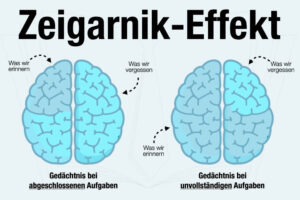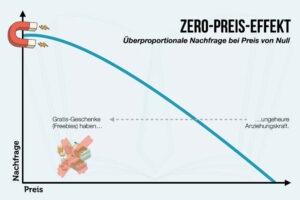Definition: Was ist der Proteus Effekt?
Der Proteus-Effekt beschreibt den psychologischen Einfluss eines Avatars in der virtuellen Welten auf die realen Eigenschaften oder Verhaltensweisen einer Person. Tatsächlich wählen Menschen diese digitalen Alter Egos nicht nur zur Selbstdarstellung im Internet oder um sich ein – meist besseres – Image zu geben. Die Avatare wirken umgekehrt auch auf die Persönlichkeit zurück.
Seinen Namen verdankt der Effekt der Sagenfigur Proteus. In der griechischen Mythologie ist der ein Meeresgott, der dem Poseidon unterstellt war und vor allem dessen Robben rund um die Inseln Karpathos und Pharos hütete. Falls die Menschen versuchten, ihm ein paar Weissagungen zu entlocken, entzog er sich ihnen, indem er sich in allerlei Zeugs verwandelte: Mal schlüpfte er in die Gestalt von Löwen, mal waren es Schlangen, Leoparden, Eber oder gar Bäume und Elemente wie Wasser oder Feuer. Der mythische Meeresgott gilt daher als Meister der Verwandlung, der jede beliebige Form annehmen konnte – so wie die Menschen heute im Internet.
Was ist ein Avatar?
Ursprünglich stammt der Begriff aus dem Sanskrit (Avatāra) und bedeutet so viel wie Abstieg. Beschrieben wurde damit eine Gottheit, die aus ihren himmlischen Sphären herabsteigt, um eine irdische Daseinsform anzunehmen.
Heute beschreibt der Begriff Avatar mehrheitlich eine Kunstfigur oder den grafischen Stellvertreter einer realen Person im Internet – in Computerspielen, in Foren, Blogs, sozialen Netzwerken oder dem Metaverse. Oft zeigen die Profilbilder stilisierte Porträts, Gegenstände oder Symbole.
Wie wirkt der Proteus-Effekt?
Das Internet und Metaverse erlaubt uns jemand zu sein, der wir gerne wären. Eher klein geratene Brillenschleichen verwandeln sich dort zu muskelbepackten Hünen in schillernden Rüstungen; Mauerblümchen avancieren zu vollbusigen Amazonen mit wallenden Blondmähnen und männermordenden Figuren, die keine Atkins- und keine Brigitte-Diät je so hingehungert bekommen.
Die digitale Metamorphose wird zur Bühne für multiple Persönlichkeiten und zum Seelenspiegel für das menschlichste aller Gefühle: jemand anderes oder zumindest mehr zu sein als man wirklich ist.
Proteische Persönlichkeiten
Proteische Persönlichkeiten nannte der amerikanische Psychologe Robert J. Lifton im Jahr 1993 erstmals solche Verhaltensweisen, woraus der US-Soziologe Jeremy Rifkin sieben Jahre später einen populären Begriff für den vernetzten Menschen des 21. Jahrhunderts machte. Im positiven Sinne beschreibt der den modernen Menschen als extrem anpassungsfähig und flexibel. Man könnte auch sagen: Im Internet schlüpfen wir in diverse Rollen und führen uns auf, als seien wir Legion.
Der Proteus-Effekt aber zeigt, dass wir nicht nur im Netz spielerisch beeinflussen können, wie uns andere sehen und wie wir auf andere wirken – die künstlichen Alter Egos wirken auch auf uns, unsere Psycheund unser Verhalten…
-
Attraktive Avatare machen mitteilsam
Der Wissenschaftler Nick Yee von der Stanford Universität fand heraus, dass Nutzer eines besonders attraktiven Avatars ihr (reales) Leben bereitwilliger vor Fremden ausbreiteten und auch schneller gegenüber andersgeschlechtlichen Bekanntschaften intim wurden.
-
Große Avatare machen unfair
In einer weiteren Studie zeigte sich, dass Nutzer eines auffällig großen Avatars zunehmend unfair bis aggressiv in Verhandlungen wurden – besonders gegenüber Teilnehmern mit einem eher kleinwüchsigen Kunst-Ich. Diese virtuell antrainierten Verhaltensmuster behielten die Betroffenen aber zugleich im realen Leben bei.
-
Dunkle Avatare machen aggressiv
Die Forscher Jorge Peña von der Universität Austin und Jeffrey Hancock von der Cornell Universität wiederum konnten zeigen: Wer zuvor in die Rolle eines schwarz gekleideten Avatars (ähnlich dem typischen Anzug eines Managers) geschlüpft war, wurde dadurch aggressiver und weniger teamfähig.
-
Aktive Avatare machen sportlich
Die Kommunikationswissenschaftlerin Jesse Fox am Stanford Virtual Human Interaction Lab forschte Anfang 2010 in Sachen Proteus-Effekt und fand heraus: Nutzten die Probanden Avatare, die ihnen ähnlich sahen und in der virtuellen Welt aktiv waren, hatten Teilnehmer prompt das Bedürfnis, ebenfalls real eine Stunde länger Sport zu machen.
Psychologen vermuten, dass die Wirkung des Proteus-Effekt auf einer Art psychologischem Priming beruht. Dabei wird das Gehirn durch subtile und meist unbewusste Reize in eine Richtung beeinflusst. Der Begriff stammt aus dem Neurolinguistischen Programmieren (NLP) und bedeutet wörtlich to prime = vorbereiten.
Hat der Proteus-Effekt Vorteile?
Die Studien lassen den Schluss zu, dass wir im Netz nicht nur spielerisch die Wahrnehmung unserer eigenen Person beeinflussen können, sondern ebenso mit der Zeit unser Selbstbild und Verhalten beeinflussen – positiv wie negativ.
Der Proteus-Effekt kann dazu führen, dass sich geschlechtsspezifische Stereotype eher noch verfestigen. Gleichzeitig können wir ebenso unsere sozialen Kompetenzen verbessern. Studien um Fernanda Herrera mit Virtual Reality (VR) zeigen, dass die Teilnehmer anschließend über ein deutlich höheres Maß an Empathie verfügten.
5 Fakten über Avatare, die Sie noch nicht kannten
-
Vertrauen
Avatare wirken umso glaubwürdiger, je deutlicher ihr Geschlecht zu erkennen ist. Das fand eine Studie an der Universität von Connecticut heraus. Damit scheiden Gegenstände und Symbole eher aus. Am vertrauenswürdigsten erschien die Person hinter dem Avatar, wenn dessen Cyberzwilling einen Anzug oder ein Kleid trug sowie Haare hatte, die ihn oder sie deutlich als Mann oder Frau kennzeichneten.
-
Zufriedenheit
Je zufriedener ein Mensch mit sich selbst ist, desto mehr ähnelt ihm sein Avatar, fanden die Medienpsychologen Sabine Trepte und Leonard Reinecke von der Hamburg Media School heraus. Wer dagegen mit seinem Leben unglücklich war, schlüpfte virtuell umso stärker in eine Phantasierolle.
-
Hilfsbereitschaft
Das Klischee stimmt: Weiblichen, attraktiven Avataren wird im Netz häufiger geholfen als anderen Kunstfiguren, ermittelte eine Studie der TU Chemnitz. Untersucht hatten die Forscher das Verhalten im Online-Rollenspiel „World of Warcraft“. Dabei erhielten attraktive Frauen-Avatare deutlich mehr Unterstützung (46,6 Prozent) als unattraktive (23,3 Prozent).
-
Misstrauen
Sieht der digitale Doppelgänger zu sexy aus, wird die Person als weniger vertrauenswürdig eingeschätzt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Indiana Universität. Je leichter bekleidet und je üppiger die Brüste einer Kunstfrau waren, desto weniger Mitgefühl zeigten die (männlichen) Versuchsteilnehmer.
-
Abhängig
Computerspielsüchtige zeigen eine besonders enge Bindung zu ihrem Avatar. Das fand David Smahel von der Masaryk Universität im tschechischen Brünn heraus. Löst die Computerspielfigur zum Beispiel eine Aufgabe nicht oder verliert diese gegen andere Avatare, schämen sich die Betroffenen noch lange im realen Leben dafür – wieder ein Beleg für den Proteus-Effekt.
Was andere dazu gelesen haben