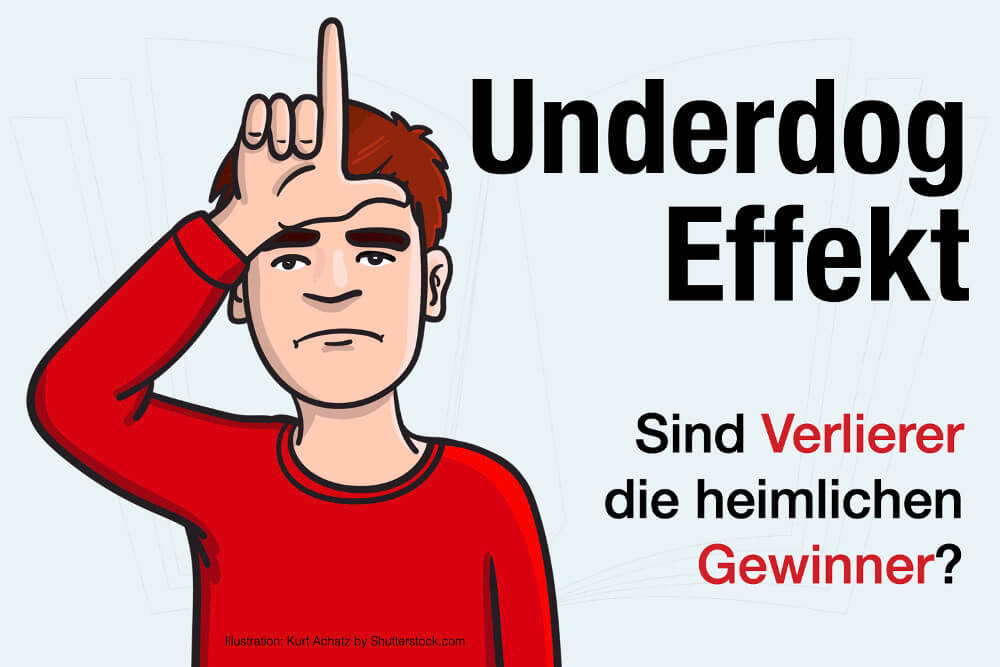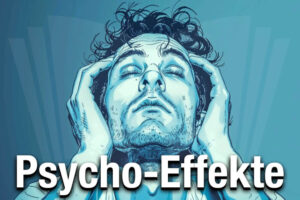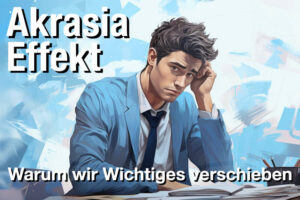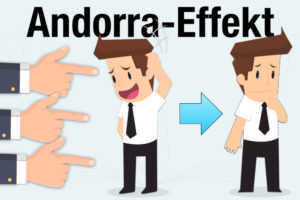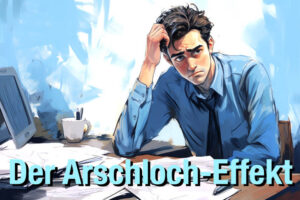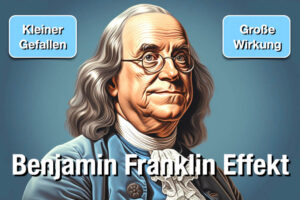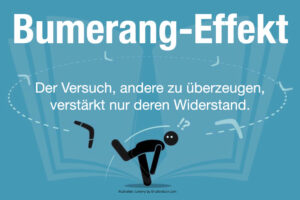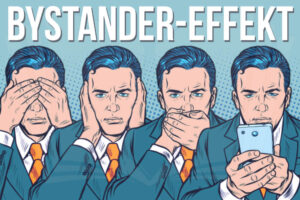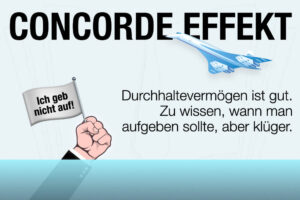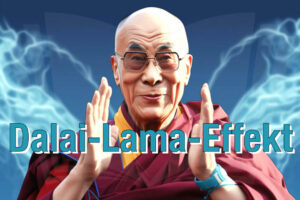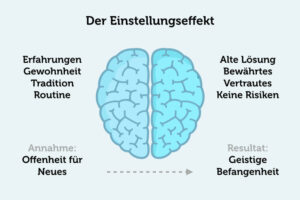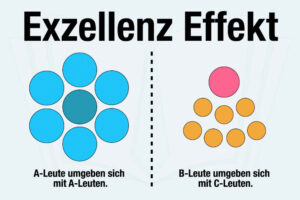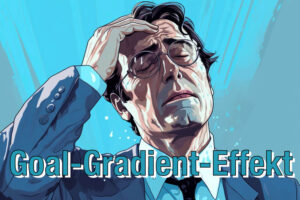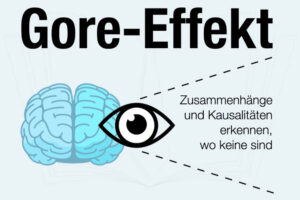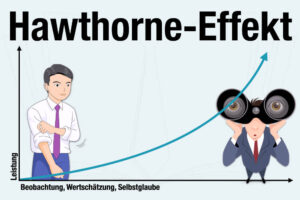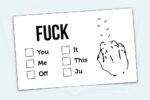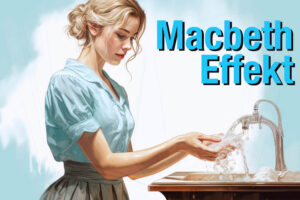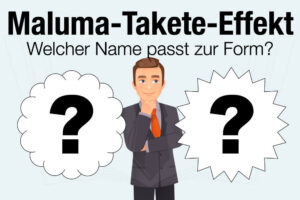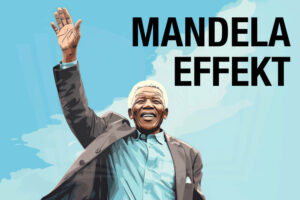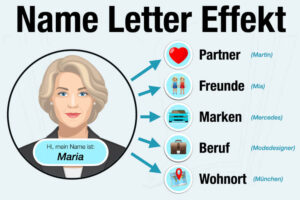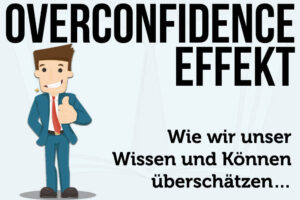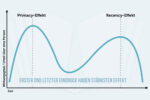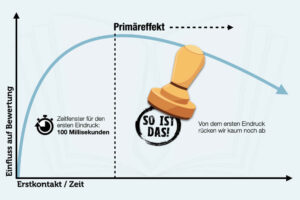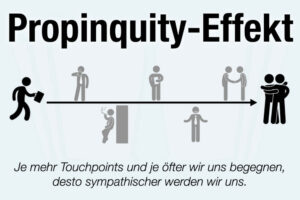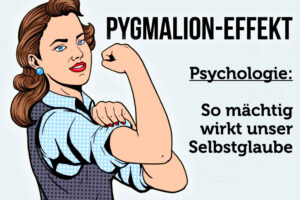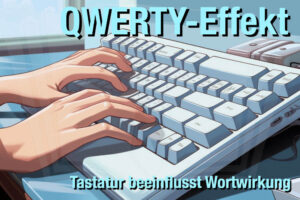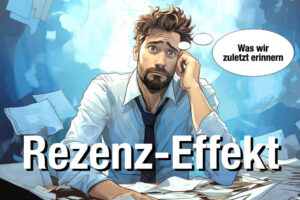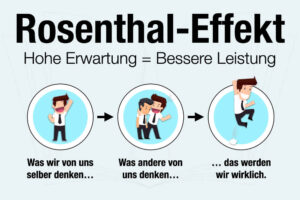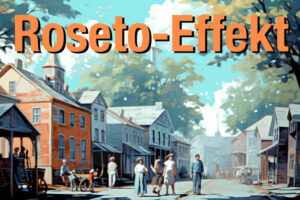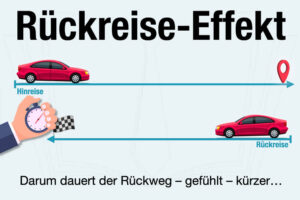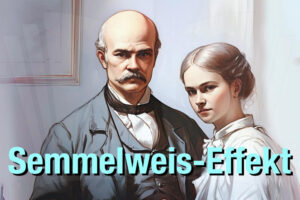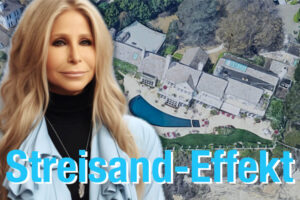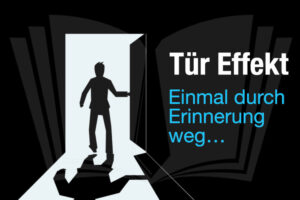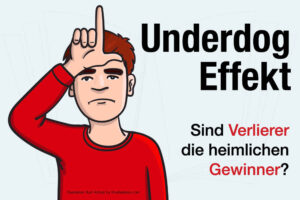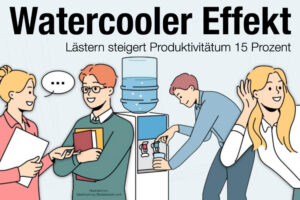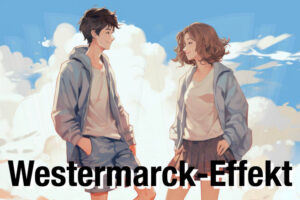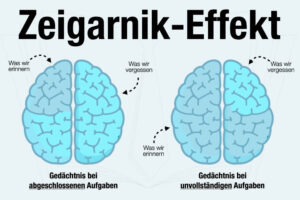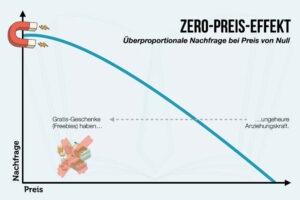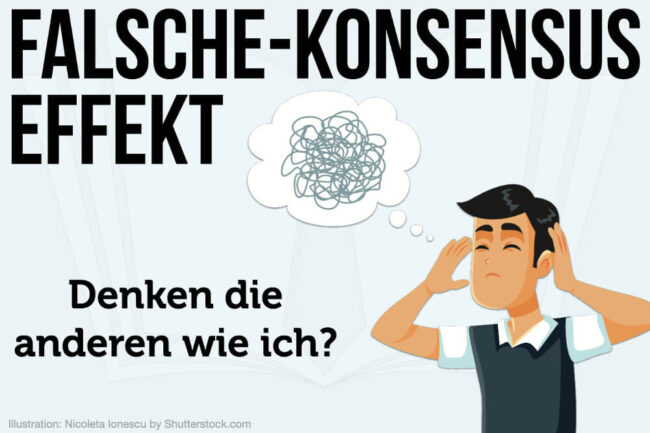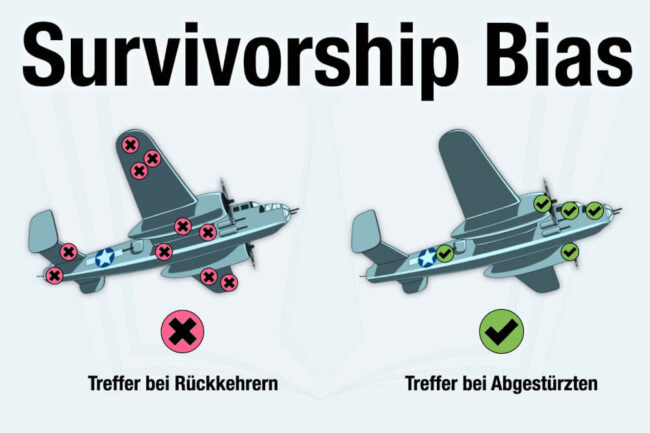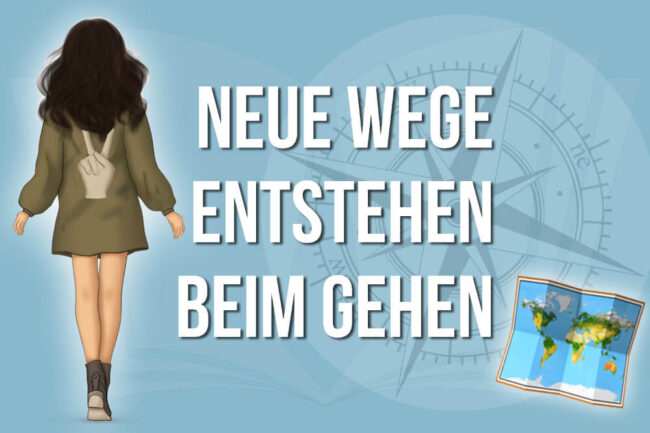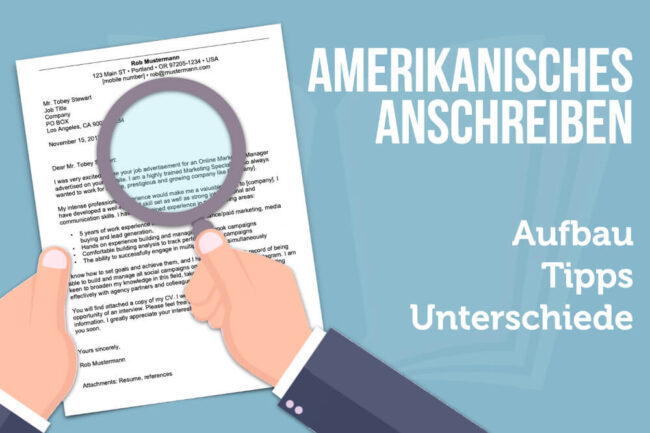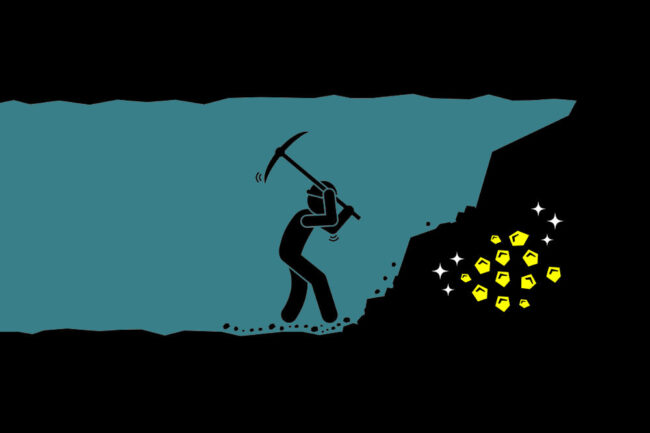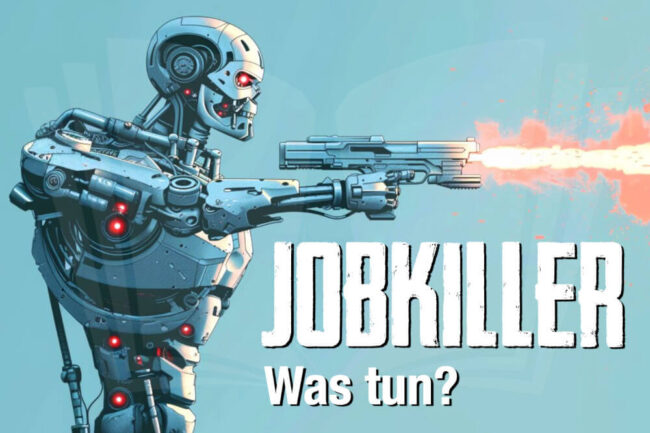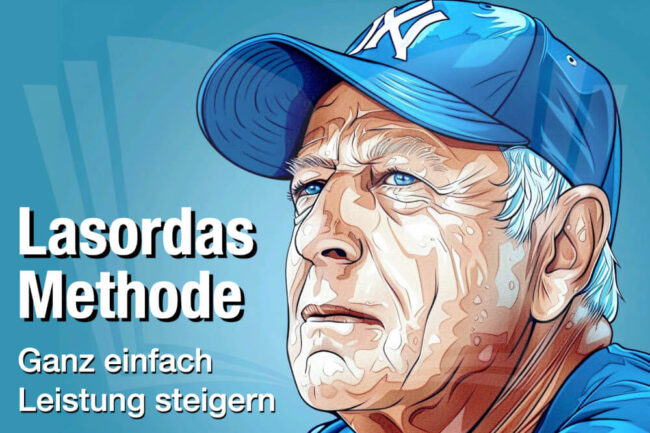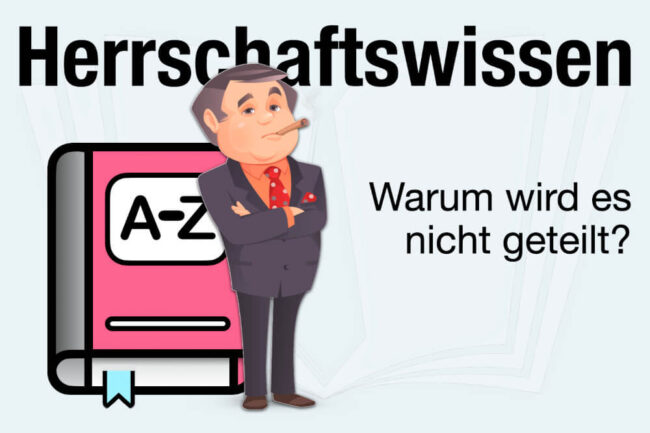Definition: Was ist der Underdog-Effekt?
Der Underdog-Effekt (auch: Außenseitereffekt) beschreibt das Phänomen in der Psychologie, dass die Masse überraschend oft mit dem Außenseiter oder Verlierer sympathisiert statt mit dem offensichtlichen Gewinner. Das Gegenteil dazu ist der sogenannte Bandwagon-Effekt.
Der Underdog-Effekt tritt nicht nur im Sport auf, sondern auch bei politischen Debatten und Wahlen sowie beim Einkaufen und Konsumverhalten. Im letzten Fall handelt es sich jedoch eher um eine Art Abwehrreaktion gegenüber allzu penetranter Werbung oder einer arroganten Marke. Sobald diese die Konkurrenzprodukte besonders schlecht macht, werden diese für viele Menschen erst recht attraktiv. Die Verbraucher entscheiden sich dann für den kleinen David – aus Solidarität oder Trotz. Daher auch: David-Goliath-Effekt.
Bedeutung: Was ist ein Underdog?
Underdogs sind in der Soziologie Menschen, die in der sozialen Rangordnung am unteren Rande der Gesellschaft stehen oder sozial Benachteiligte. Wortwörtlich steht der englische Begriff für „unterlegener Hund“. Synonym dazu verwenden wir in Deutschland den ebenfalls englischen Begriff „Loser“ oder Verlierer.
Das Gegenteil zum Underdog ist der „Topdog“ – in amerikanischen Filmen gerne durch einen Highschool-Schwarm dargestellt, der zugleich Top-Basketballer oder Quarterback im Football ist.
Warum ist man für den Underdog?
Menschen sympathisieren vor allem deshalb mit dem Underdog, weil das auf sie eine beruhigende Wirkung hat. Wer mit einer Niederlage rechnet, kann nicht enttäuscht werden und kann dem Wettkampf mit mehr Gelassenheit zuschauen. Das gilt nicht nur für die Fans und Zuschauer, sondern ebenso für Spieler mit Wettkampfangst.
Studien zum Underdog-Effekt
Bereits 1992 untersuchte Edward Hirt von der Indiana Universität den Underdog-Effekt und beobachtete dabei das Verhalten von männlichen Basketball-Fans. Gewann deren favorisierte Mannschaft, stieg unmittelbar deren Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Übrigens auch bezogen auf ihre Wirkung beim anderen Geschlecht. Verlor das Basketballteam jedoch, waren die Probanden am Boden zerstört – und irgendwo in der Lache aus Bier, Tränen und Frust tropfte auch ihr Selbstwertgefühl in den Rinnstein…
Ganz anders bei den Fans von Underdogs. Sie sahen von vornherein keinem triumphalen Moment entgegen, rechneten nicht mit einem Sieg oder einer Prämie bei einer Sportwette. Ihr Selbstwertgefühl blieb konstant. Gab es aber einen Überraschungssieg, war die Freude umso gewaltiger. Und im Beispiel der Sportwette gab es auch noch die bessere Quote. Es lohnt sich oft mehr, auf Außenseiter zu setzen.
Gewinner machen Spaß, Underdogs schließen wir ins Herz
Bestätigt wird dies von Studien um Jimmy Frazier und Eldon Snyder von der Bowling Green State Universität aus dem Jahr 1991. Dabei gab es zwei Sportmannschaft – A und B. Wobei Team A zunächst als Favorit gehandelt wurde. Effekt: Anfangs drückten 81 Prozent der Probanden dem Underdog-Team B die Daumen.
Dann aber erzählten die Wissenschaftler den Teilnehmern, Team B hätte es irgendwie geschafft, die ersten drei Runden deutlich für sich zu entscheiden. Was passierte? Genau: Rund die Hälfte derjenigen, die zunächst Team B die Treue schworen, wechselten ihre Allianz nun zu Team A. Nur, weil diese Mannschaft nun der Außenseiter war.
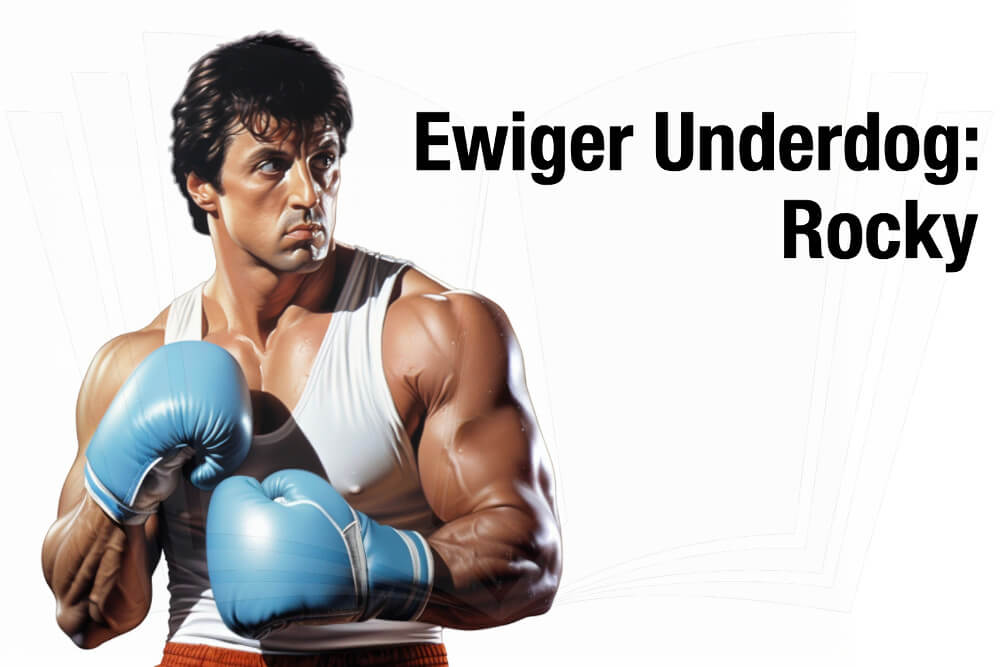
Was macht Underdogs so attraktiv?
Was Underdogs so attraktiv macht: Sie haben vielleicht nicht die Stärke, die Klasse und die Intelligenz der Favoriten – aber sie haben Herz und Leidenschaft – sogar im doppelten Wortsinn: Sie können leiden. Und das zieht alle in den Bann.
Geschätzte 99 Prozent aller Heldenepen basieren auf dem Prinzip: Kill Bill, Gladiator, Braveheart. Am Anfang sieht es jedes Mal schlecht aus für die Protagonisten, aber sie geben nicht auf, bleiben zäh und kämpfen sich nach oben hin durch. Okay, in den beiden letzten Filmen sterben sie auch dafür – aber hey: Was für ein Abgang!
Grund: Bedürfnis nach ausgleichender Gerechtigkeit
Natürlich ist das alles nur Kino. Seifenschaum. Im echten Leben strengen sich Underdogs leider nicht immer so an. Und sie gewinnen auch seltener. Aber wir wünschen uns zumindest, es wäre so. Weil wir vielleicht irgendwann auch mal der Außenseiter sind oder waren. Und weil wir alle das Bedürfnis nach Harmonie und ausgleichender Gerechtigkeit in uns tragen. Überdies können Superstars extrem einschüchtern (siehe: Superstar-Effekt).
Es ist wie bei David und Goliath: Irgendwann muss so ein Großmaul wie Goliath doch bitteschön endlich auf die Zwölf bekommen! Umso besser, wenn den Part ausgerechnet ein Panflöte spielender Zwerg übernimmt. Welche eine Schande für den eitlen Protz – und was für ein Triumph für den Underdog, auf den wir von Anfang an gesetzt haben…
Was andere dazu gelesen haben