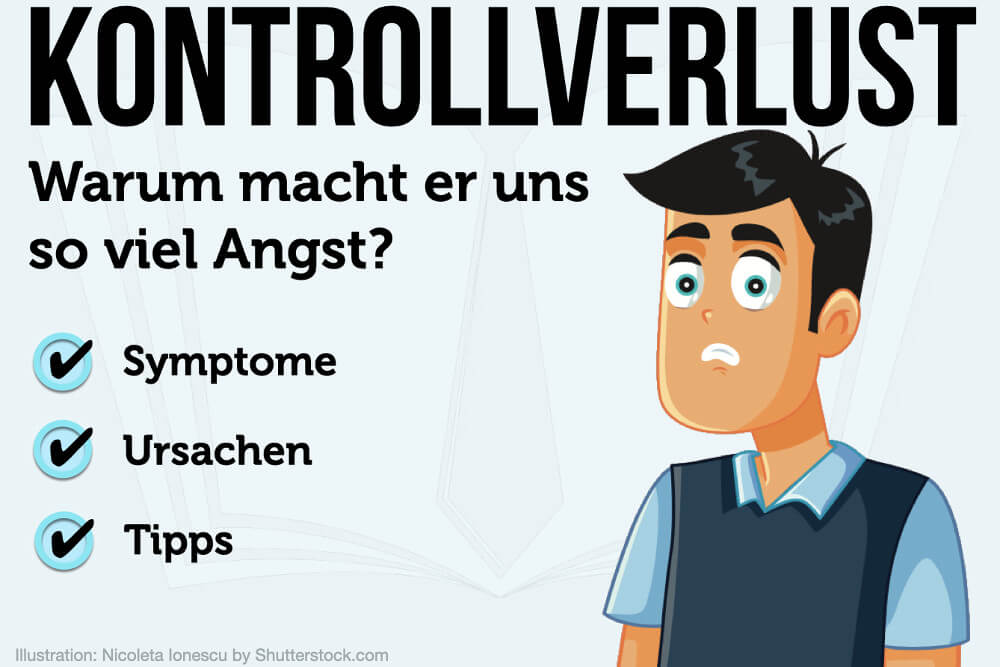Bedeutung: Was ist Kontrollverlust?
Kontrollverlust ist das Gefühl oder die tatsächlich verminderte Fähigkeit, Situationen selbst zu steuern, das eigene Handeln zu bestimmen oder die eigene Umgebung zu beeinflussen. Es ist die Unfähigkeit zur Einflussnahme auf den weiteren Verlauf. Sie haben keinerlei Kontrolle über das, was passiert.
In Medizin und Psychologie ist Kontrollverlust ein Symptom und eine Folge von Suchtverhalten. Durch beispielsweise Drogen- oder Alkoholkonsum verlieren Betroffene die Fähigkeit, das eigene Denken und Handeln zu steuern.
Beispiele für Kontrollverlust
Im Beruf empfinden Arbeitnehmer einen Kontrollverlust, wenn der Chef einen Stellenabbau ankündigt. Sie selbst haben keinerlei Einfluss darauf, ob Sie den Job behalten oder gekündigt werden.
Viele beschreiben das Gefühl auch bei Flugreisen. Wer in ein Flugzeug steigt, hat keinerlei Einfluss darauf, was bis zur Landung passiert. Das empfinden viele Menschen als unangenehm.
Symptome für Kontrollverlust
Ein Kontrollverlust zeigt sich natürlich zuerst durch das Gefühl, dass Sie die Situation nicht mehr selbst steuern können. Damit verbunden ist eine große Angst – und zahlreiche weitere Symptome, die Betroffene in unterschiedlicher Kombination und Stärke erleben:
- Panikattacke
- Hilflosigkeit
- Innere Unruhe
- Frust
- Wut
- Übelkeit
- Kopfschmerzen
- Psychische Belastung
- Herzrasen
- Akute Nervosität und Stress
In starken Ausprägungen kann die Angst vor Kontrollverlust bis zu psychischen Erkrankungen führen. Betroffene entwickeln Phobien und richten ihr gesamtes Handeln darauf aus, immer die Kontrolle zu behalten.
Ursachen: Woher kommt die Angst vor Kontrollverlust?
Es gibt zahlreiche Dinge im Leben, auf die Sie keinen Einfluss haben. Es liegt nicht in Ihrer Hand, wie das Wetter wird, ob Sie auf dem Weg zur Arbeit im Stau stehen oder Ihr Zug ausfällt. Trotzdem ist die Angst vor Kontrollverlust weit verbreitet. Dahinter stehen gleich mehrere Ursachen:
- Wunsch nach Sicherheit
Die meisten Menschen streben nach Sicherheit. Durch eigene Kontrolle können wir Unsicherheiten vermeiden. Sie gibt uns eine gewisse Macht über die Situation. Können wir etwas nicht mehr kontrollieren, werden wir zum Opfer der Umstände – das macht Angst. - Sorge um Abhängigkeit
Bei einem Kontrollverlust werden wir abhängig von den Entscheidungen und dem Verhalten anderer Menschen. Die Situation raubt die Eigenständigkeit und Selbstverantwortung Stattdessen müssen wir hoffen, dass andere in unserem Sinne handeln. - Furcht vor Ablehnung
Wir fürchten den Verlust der Kontrolle auch, weil wir Angst vor der Reaktion von Mitmenschen haben. Was denken Freunde oder Kollegen, wenn Sie merken, dass wir die Situation nicht mehr im Griff haben? Um keine Kritik oder Ablehnung zu erfahren, wollen wir krampfhaft die Kontrolle behalten. - Eintreten unvorhersehbarer Ereignisse
Eine verbreitete Ursache für die Angst vor Kontrollverlust ist die Möglichkeit unvorhergesehener Ereignisse. Es wird überlegt und geplant, doch plötzlich haben Sie keinerlei Kontrolle mehr und alles geht schief.
Lässt sich Kontrollverlust verhindern?
Die scheinbar logische Lösung für das Problem: Sie verhindern den Kontrollverlust und sorgen dafür, dass Sie stets alles bestimmen und beeinflussen können. Leider funktioniert genau das nicht. Es wird immer Situationen geben, auf die Sie schlicht keinerlei Einfluss haben – ganz egal, wie sehr Sie sich anstrengen und es sich wünschen.
Manche Rahmenbedingungen lassen sich nicht ändern und einige Entscheidungen werden von anderen Menschen getroffen. Die Angst vor Kontrollverlust überwinden Sie nicht, indem Sie daran etwas ändern. Besser wird es erst, wenn Sie akzeptieren, dass Sie nicht immer die Kontrolle haben können.
Wann müssen Sie etwas gegen Angst vor Kontrollverlust tun?
Eine gewisse Angst vor Kontrollverlust ist normal. Das Bestreben, die eigene Situation, das direkte Umfeld und die folgenden Entwicklungen zu kontrollieren, ist nur menschlich. Wenn Sie mit etwas Unbehagen daran denken, dass Sie manchmal die Kontrolle aus der Hand geben müssen, besteht deshalb nicht gleich akuter Handlungsbedarf.
Unbedingt aktiv werden sollten Sie, wenn die Angst Ihr Verhalten spürbar beeinflusst. Vermeiden Sie beispielsweise bewusst bestimmte Situationen, die Sie nicht kontrollieren können oder spüren Sie starke Belastungen durch Druck, Unruhe und Stress, müssen Sie daran arbeiten.
Tipps: So überwinden Sie die Angst vor Kontrollverlust
Sie werden auch in Zukunft Situationen erleben, die Sie nicht kontrollieren können. Damit Sie damit besser umgehen und Ihre Angst reduzieren können, helfen diese fünf Tipps:
-
Verstehen Sie die Auslöser
Je besser Sie die Auslöser verstehen, desto leichter können Sie Ihre Angst vor Kontrollverlust überwinden. Wollen Sie nicht von anderen abhängig sein? Haben Sie schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht? Wer die Auslöser kennt, entwickelt größeres Verständnis für die eigenen Gefühle und kann daran arbeiten.
-
Entwickeln Sie mehr Gelassenheit
Gelassenheit gibt Ihnen die nötige Ruhe, um schwierige Situationen ohne Angst zu meistern. Der erste Schritt ist die Akzeptanz, dass Sie nicht alles ändern und beeinflussen können. Das fällt anfangs schwer. Wenn Sie es aber schaffen, können Sie leichter die Kontrolle abgeben.
-
Analysieren Sie die Situation
Ein Kontrollverlust wird als großes Problem empfunden und soll deshalb unbedingt verhindert werden. Tatsächlich ist es in einigen Situationen aber gut und sinnvoll, dass jemand anders am Steuer sitzt. Im obigen Beispiel des Flugzeugs: Es sitzt ein gut ausgebildeter und erfahrener Pilot im Cockpit. Zwar müssen Sie die Kontrolle abgeben – aber in Hände, die für die Aufgabe weitaus besser ausgebildet sind.
-
Betrachten Sie die Konsequenzen rational
Bei einem Kontrollverlust gehen wir stets vom schlimmsten Ergebnis aus. Alles wird eine Katastrophe, weil wir es nicht selbst beeinflussen können. Verlassen Sie diesen emotionalen Standpunkt und betrachten Sie die Lage rational. Selbst der Worst Case ist in den meisten Fällen nur halb so schlimm, wie Sie es sich vorstellen.
-
Hinterfragen Sie Ihre Möglichkeiten
Es ist leicht, einen Kontrollverlust zu empfinden – dieser muss aber gar nicht real sein. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, um zumindest Teile der Entwicklung zu kontrollieren. Sprechen Sie beispielsweise mit dem Chef und erarbeiten Sie gemeinsam Ideen, statt nur auf seine Entscheidung zu warten.
Was andere dazu gelesen haben