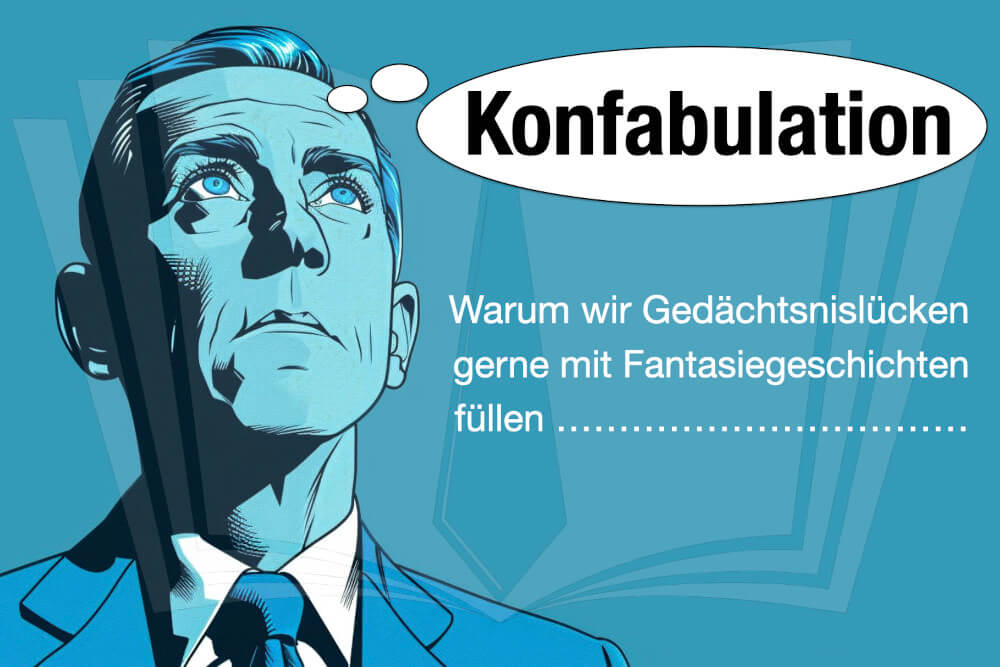Definition: Was ist Konfabulation?
Konfabulation bezeichnet das Erfinden von objektiv falschen Begebenheiten und Informationen oder Füllen von Gedächtnislücken durch frei erfundene Geschichten (= „Fabeln“, daher der Name), die nichts mit der Realität zu tun haben.
Im Unterschied zu Lügen ist derjenige, der konfabuliert, jedoch fest davon überzeugt, dass seine Angaben wahr oder zumindest wahrscheinlich sind. Deshalb beharren Betroffene auch bei kritischen Nachfragen auf ihrer Version und wollen sich mit ihren Fabeln auch nicht profilieren.
Psychologie: Was sind die Ursachen für Konfabulation?
Bis heute sind die Ursachen für Konfabulation nicht eindeutig geklärt. Dies liegt zum Teil auch daran, dass das Phänomen unterschiedliche Formen hat: Manche Konfabulationen basieren auf einer falschen Wahrnehmung (siehe: Bias), andere sind auf eine Fehlfunktion des Gedächtnisses oder Hirnschädigung zurückzuführen. Die häufigsten Ursachen hierfür sind:
-
Konfabulation bei Alkoholismus
Das Wernicke-Korsakow-Syndrom beschreibt eine Erkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS), die durch Alkoholmissbrauch entsteht. Dadurch kommt es zu einem Thiaminmangel, der das Gehirn schädigt und damit auch die Erinnerung.
-
Konfabulation bei Psychose
Typisch für Patienten mit psychischen Erkrankungen sind Wahnvorstellungen oder Halluzianationen. Auch diese können durch Alkohol- oder Drogenmissbrauch ausgelöst werden. Dasselbe gilt für traumatische Erlebnisse. Diese Patienten neigen ebenfalls zur Konfabulation.
Arten der Konfabulation
Unterschieden werden in der Psychologie heute vor allem zwei Arten der Konfabulation:
-
Spontane Konfabulation
Die seltenere Form enthält häufig phantastische Inhalte, die völlig irreal sind und daher leicht als Hirngespinst zu erkennen sind. Diese Form ist fast immer auf eine Hirnschädigung zurückzuführen.
-
Provozierte Konfabulation
Häufiger ist diese Form, bei der Personen Inhalte wiedergeben, die zwar plausibel und verständlich sind, aber sachlich falsch. Hervorgerufen werden diese Konfabulationen zum Beispiel durch Suggestivfragen oder ein schlechtes Gedächtnis (siehe auch: Déja-vu).
Konfabulation hilft beim Selbstbild
Positiv: Konfabulation hilft uns dabei, eine Identität zu entwickeln. Sie erleichtert den Umgang mit der eigenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – und stärkt damit das Selbstbild und Selbstwertgefühl. Statt sich eigenen Schwächen zu stellen, ermöglicht Konfabulation den Eindruck von uns – nach innen wie außen – zu vermitteln, den wir uns wünschen. Auch wenn die Geschichte zu schön ist, um wahr zu sein.
Was sind Konfabulation Beispiele?
Grundsätzlich können auch gesunde Menschen konfabulieren. Es völlig normal, dass uns unsere Erinnerung manchmal einen Streich spielt und wir Dinge oder Gespräche erinnern, die es so nie gab. Oft geschieht dies aus Verlegenheit oder um Gedächtnislücken zu kaschieren – nicht aus Geltungssucht, wie beim pathologischen Lügen (Pseudologica phantastica).
Beispiel Bewerbung: Gerade im Vorstellungsgespräch wollen sich Kandidaten stets von der besten Seite präsentieren. Auf ihre bisherige Arbeitsweise oder Erfolge angesprochen, wird dann häufig konfabuliert, um Personaler von dem tadellosen Lebenslauf oder einer bisherigen Top-Performance zu überzeugen (siehe auch: Interviewer Bias).
Beispiel Erfolg: Ein Klassiker der Konfabulation ist der typische Rückschaufehler, dass der Erfolg genauso geplant war. Aus Glück und Zufall werden ein strategischer Plan, der aufgegangen ist (siehe auch: Confirmation Bias).
Beispiel Bystander-Effekt: Der sog. Zuschauereffekt beschreibt, warum viele Menschen im Notfall nicht eingreifen, sondern nur zusehen, wegsehen oder gar gaffen und hinterher eine Geschichte erfinden, warum sie nicht helfen konnten. Nichts hören, nichts sehen, nichts tun: Tatsächlich nimmt bei jedem Notfall die Wahrscheinlichkeit, dass einem geholfen wird, mit steigender Anzahl der Umstehenden ab. Kurz: Je mehr Menschen zuschauen, desto weniger greifen ein.
Was andere dazu gelesen haben