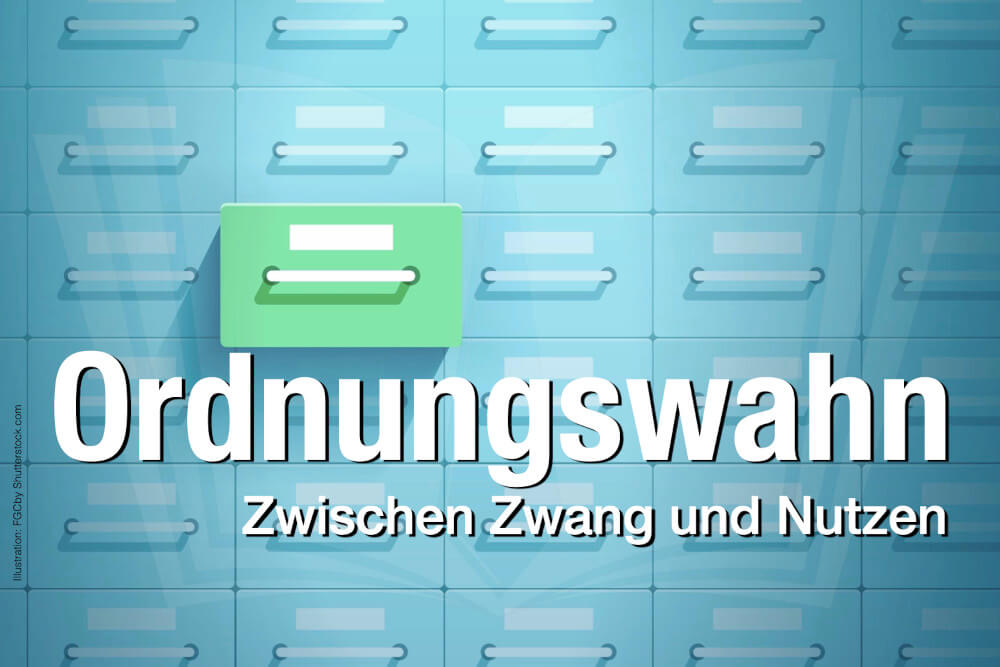Definition: Was ist Ordnungswahn?
Ordnungswahn (auch: Ordnungszwang) ist die umgangssprachliche Bezeichnung für einen Menschen, der immer wieder und zwanghaft versucht, Gegenstände, Stifte, Bücher oder Kleidungsstücke zu ordnen oder in eine bestimmte (geometrische, farbliche) Ordnung zu bringen.
Im Gegensatz zur Ordnungsliebe handelt es sich beim Ordnungszwang um eine Zwangsstörung, die als Krankheit im ICD-10 klassifiziert ist. Dabei wird zwischen zwei Formen von Zwangsstörungen unterschieden:
-
Zwangsgedanken
Dazu gehören Zählzwang, Grübelzwang, zwanghaft aggressive Gedanken, ständige Ängste oder Zweifel.
-
Zwangshandlungen
Hierunter zählen Zwänge wie Berührzwang, Kontrollzwang, Waschzwang oder eben der Ordnungszwang.
Wie äußert sich Ordnungszwang?
Menschen mit Ordnungszwang haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Symmetrie, Systematik und Harmonie. Ein schiefes Bild an der Wand können sie schlecht ertragen, Gegenstände auf Tischen oder im Raum müssen sie nach einer besonderen Ordnung arrangieren.
Wird diese Symmetrie durcheinandergebracht – zum Beispiel, weil ein Kollege oder der Partner daheim nicht so ordentlich ist oder sein Zeug irgendwo ablegt, erleben Betroffene ein starkes Störgefühl und Unbehagen, dass sogar die Lebensqualität beeinträchtigen kann.
Exzentriker oder Pedant?
Ordnungsfanatiker brauchen die strikte Ordnung um sich herum, um sich wohlzufühlen. Damit wirken sie auf Außenstehende teils pedantisch oder wie Exzentriker, die ihre Marotten pflegen.
Der Grat zwischen ausgeprägtem Ordnungssinn, einem lustigen Spleen und echter Zwangsstörung ist jedoch schmal und nicht immer eindeutig zu diagnostizieren. Nicht jeder, der eine Aversion gegen Unordnung hat oder gerne aufräumt und alles ordentlich sortiert, ist psychisch krank. Daher gilt bei psychologischen Etikettierungen: Nicht vorschnell urteilen!
Was sind die Ursachen für Ordnungswahn?
Für Ordnungswahn kann es verschiedene Ursachen und Auslöser geben. Manchmal sind die Menschen auch nur ordentlich, weil sie es müssen – weil zum Beispiel im Unternehmen eine Clean Desk Policy existiert. Auch verhalten sich manche auf der Arbeit anders als zuhause.
Generell aber liegen die Ursachen für Ordnungswahn in der beabsichtigten Funktion:
-
Sicherheit
Alles ist an Ort und Stelle – das gibt Menschen mit Ordnungswahn das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Das Leben verläuft in geordneten Strukturen – und man selbst hat das im Griff.
-
Bequemlichkeit
Ordnungsliebhaber suchen ungerne. Entsprechend entwickeln sie Systeme und Strukturen, die ihnen die Arbeit und den Alltag erleichtern. Eine Form der intelligenten Faulheit.
-
Aktionismus
Ebenso kann hinter Ordnungswahn Aktionismus stecken – ein Art Ablenkung und Prokrastination, um sich vor der eigentlichen Aufgabe zu drücken.
-
Überforderung
Zum Teil verrät Ordnungswahn auch jemanden, der Probleme damit hat, Prioritäten zu setzen. Die Ordnung hilft, den fehlenden Überblick zu schaffen und sich zu organisieren.
Ordnungwahn oder kreativer Geist?
„Ordnung ist das halbe Leben – ich lebe in der anderen Hälfte.“ – Der lustige Spruch ist das Credo der Unordentlichen und Chaoten. Ordnungsliebende Menschen sind ihnen suspekt. Tatsächlich zeigen Studien um Kathleen Vohs von der Universität von Minnesota, dass Chaos die Kreativität fördert.
Ist Ordnungswahn nur schlecht?
Alles, was zwanghaft ist und den Menschen einschränkt, ist schlecht. Zwanghaftes Ordnen, Aufräumen und Sortieren gehört dazu. Allerdings ist die Grauzone davor breit: Ordnung zu halten, ist ebenfalls eine Form der Selbstorganisation und Bestandteil einiger Zeitmanagement-Methoden (siehe: 5s-Methode).
Wer seinen Schreibtisch oder die Büroeinrichtung regelmäßig aufräumt und ordentlich hält, verplempert keine Zeit mit Suchen. Alles hat seinen festen Platz und ist übersichtlich angeordnet und sofort griffbereit. Effekt: Es bleibt mehr Zeit für die eigentliche Arbeit – und auch noch Platz für einen kreativen Freigeist.
Überdies können Ordnung und Sauberkeit zur Bürohygiene beitragen und dem sog. Broken-Windows-Effekt vorbeugen. Das psychologische Phänomen beschreibt, wie sich Chaos und Verwahrlosung selbst verstärken.
Tipps: Was tun bei Ordnungswahn?
Wer selbst im Kühlschrank noch die Lebensmittel streng sortiert und dafür sorgt, dass die aufgeschlagene Akte bündig mit der Schreibtischkante abschließt, schießt womöglich übers Ziel hinaus. Wichtig ist aber, dass Sie zunächst herausfinden, ob Sie dieser Ordnungswahn belastet oder gar in Richtung Zwangshandlung geht?
Solange Sie einfach nur gerne Ordnung in Ihrem Umfeld mögen (siehe: KonMari-Methode), ist alles „in Ordnung“. Falls mehr dahintersteckt, kann therapeutische Hilfe sinnvoll sein. Dort werden die genauen Ursachen untersucht und behandelt.
Was andere dazu gelesen haben