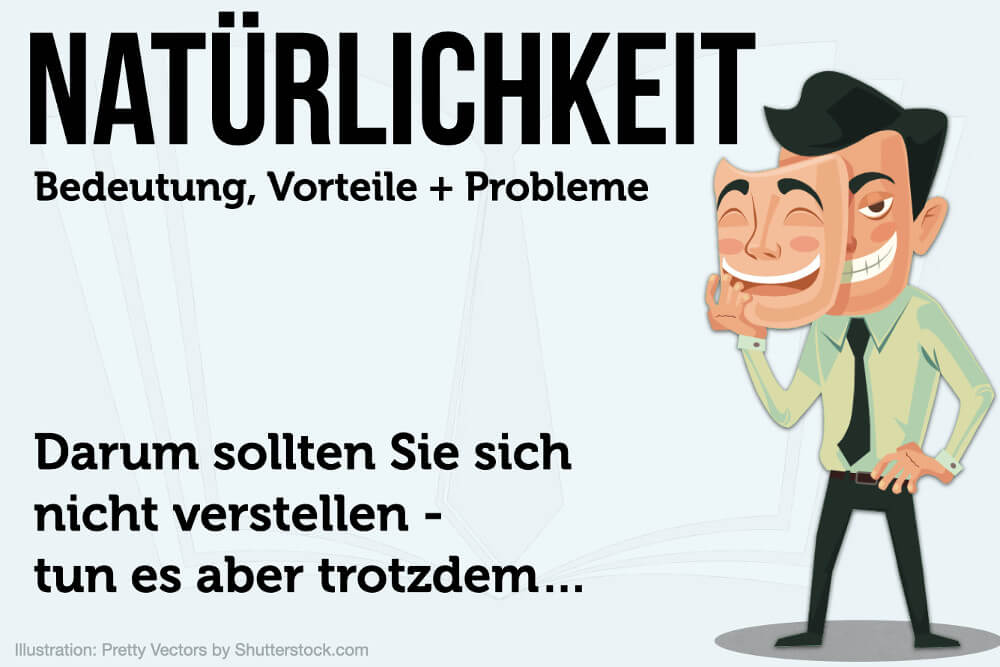Definition: Was ist Natürlichkeit?
Natürlichkeit ist ein Verhalten, bei dem Sie hundertprozentig Sie selbst sind. Sie verstellen sich nicht, sondern sind offen und ungezwungen. Natürliche Menschen müssen sich nicht anpassen oder verändern, um anderen zu gefallen. Stattdessen bleiben Sie sich selbst treu und zeigen, wer sie wirklich sind.
Natürlichkeit Synonym
Synonyme zur Natürlichkeit sind die Begriffe Aufrichtigkeit, Authentizität, Ungezwungenheit, Glaubwürdigkeit, Unverbildetheit oder auch Ehrlichkeit. Gegenteile von natürlichem Verhalten sind Falschheit, gekünsteltes, verstelltes oder affektiertes Verhalten. Betroffene Menschen wirken unecht.
Natürlichkeit ist schwer zu erkennen
Die Erwartung ist klar: Wir erwarten von unserem Umfeld unverstellte Natürlichkeit. Wer etwas vorspielt und täuscht, hinterlässt keinen guten Eindruck, sondern wird schlimmstenfalls gemieden. Allerdings ist es nicht leicht zu erkennen, wann andere Menschen natürlich sind und wann nicht. Hier einige Beispiele:
- Kleidung
Wer natürlich ist, trägt seinen eigenen Stil und rennt keinen Trends hinterher. So jemand verzichtet auf unnötigen Protz, kleidet sich angemessen und ursprünglich – so die Vorstellung. Doch vielleicht ist gerade das Bling-Bling und der extraordinäre Nonkonformismus Ausdruck der wahren Persönlichkeit. - Sprache
Natürlichkeit offenbart sich im gesprochenen Wort. Viele Fremdwörter, eine gespreizte Sprache, Bandwurmsätze – all das empfinden wir als unnatürlich, als affektiert oder aufgesetzt. Diese Erwartungshaltung verhindert, dass andere so sprechen können, wie sie es selbst wollen und für natürlich empfinden. - Körpersprache
Ähnliches gilt bei der Körpersprache. Sie ist ein starkes Signal für vermeintliche Natürlichkeit. Es ist vielleicht eines der stärksten Signale für vermeintliche Natürlichkeit. Bloß nicht zu steif sein, immer ruhig und gelassen bleiben und nicht übertrieben gestikulieren! Für manche Menschen ist das aber nicht natürlich.
Das Problem: Die eigenen Forderungen und Vorstellungen von Natürlichkeit führen den Begriff ad absurdum. Für Mitmenschen wird es schwierig bis unmöglich, wirklich natürlich zu sein. Stattdessen versuchen sie dem erwarteten Bild der Natürlichkeit zu entsprechen – und erreichen damit das genaue Gegenteil der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs.
Natürlichkeit: Aber bitte nur bei anderen
Ein zweites Dilemma der Natürlichkeit: Was wir von anderen fordern, halten wir selbst nicht ein. Während wir erwarten, dass sich andere möglichst natürlich verhalten, setzen wir selbst allzu gerne eine Maske auf und sind nicht bereit, unser wahres Ich zu offenbaren. Der Grund für diese Doppelmoral ist Selbstschutz.
Natürlichkeit macht angreifbar und verletzlich. Wenn Sie Ihren wahren Charakter zeigen, riskieren Sie Ablehnung von außen. Aus purer Angst, dass unser tiefstes Inneres gekränkt werden könnte, verstecken wir uns hinter einer Fassade. Als soziales Wesen strebt der Mensch aber nach Anerkennung und Zugehörigkeit. Wir verstellen uns, um gemocht zu werden – auch wenn es eigentlich nicht die eigene Person, sondern die angepasste Variante ist.
Kommt es doch zu Zurückweisung von anderen, ist die Ausrede gleich parat: Nicht Sie selbst wurden abgelehnt, sondern nur das Bild, das Sie vermitteln wollten. Ein typischer Selbstbetrug, um sich besser zu fühlen.
4 gute Gründe für mehr Natürlichkeit
Manchmal ist zu viel Natürlichkeit tatsächlich schädlich. Eine vollkommen ehrliche Antwort kann verletzen und die Wahrheit weh tun. Notlügen sollen nicht täuschen oder eigene Absichten verstecken, sondern den Gesprächspartner schützen. Das ist eine der wenigen Ausnahmen, in denen Natürlichkeit sich nicht auszahlt. Sonst sprechen mehrere gute Gründe dafür:
Sie können Sie selbst sein
Es ist ungemein anstrengend, wenn Sie sich immer verstellen müssen, um einer Rolle und Erwartungen zu entsprechen. Gleichzeitig laufen Sie immer Gefahr, dass diese Fassade bröckelt und Mitmenschen merken, dass sich dahinter ein ganz anderer Mensch versteckt. Durch natürliches Verhalten können Sie von Anfang an ganz Sie selbst sein.
Sie führen echte Beziehungen
Nur wenn Sie wirklich Sie selbst sind, können Sie auch echte und belastbare Beziehungen – egal, ob Freundschaft oder Liebe – aufbauen. Alle Kontakte, die Sie knüpfen, während Sie nicht natürlich sind, basieren von Anfang an auf einer Lüge.
Sie stärken Ihr Selbstvertrauen
Ihr Selbstwertgefühl und Ihr Selbstvertrauen leiden, wenn Sie nicht Sie selbst sind. Es bleibt die nagende Frage: Bin ich nicht gut genug, um mich so zu zeigen, wie ich bin? Es wird zur Gewohnheit, dass Sie sich verstellen – aus Angst, mit Ihrer wahren Persönlichkeit nicht überzeugen zu können,
Sie bauen Vertrauen auf
Natürlichkeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Vertrauen zu einem anderen Menschen. Anfängliche Zweifel verschwinden nur, wenn Sie es mit einer ehrlichen und aufrichtigen Person zu tun haben. Das gilt auch umgekehrt: Je falscher Ihr Verhalten, desto weniger vertrauenswürdig und glaubwürdig wirken Sie.

Natürlichkeit Sprüche und Zitate
Es gibt schöne und inspirierende Sprüche zur Natürlichkeit. Hier eine kleine Auswahl:
- „Der Natürliche ist anständig; nur Unnatur ist ekelhaft.“ (Carmen Sylva)
- „Natürlichkeit ist die Schwester der Freiheit.“ (Christian Morgenstern)
- „Nichts hindert uns mehr, natürlich zu sein, als das Bestreben, so zu erscheinen.“ (François de La Rochefoucauld)
- „Am schönsten sind wir, wenn wir niemandem gefallen wollen.“
- „Natürlich zu sein ist die schwierigste Pose, die man einnehmen kann.“ (Oscar Wilde)
- „Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du selbst zu sein.“ (Coco Chanel)
Natürlichkeit: 3 Anzeichen, dass Sie nicht Sie selbst sind
Wie sieht es bei Ihnen aus: Können Sie wirklich natürlich sein oder gehören Sie zu denen, die Natürlichkeit erwarten, aber sich selbst verstellen und endlose Rechtfertigungen dafür finden? Das ist keine Anklage, sondern eine provokante Frage, die zum Nachdenken anregen soll. Sind Sie wirklich noch Sie selbst? Diese drei Anzeichen sprechen dagegen:
-
Sie stehen nicht zu Ihrer Meinung
Stehen Sie zu Ihrer Meinung und sagen das, was Sie wirklich denken? Oder passen Sie sich lieber an und halten die eigenen Ansichten lieber zurück? Je häufiger Sie Ihre ehrliche Meinung verschweigen, desto eher geht die Natürlichkeit verloren. Sie antworten nur noch, um anderen zu gefallen.
-
Sie stehen nicht zu Ihren Schwächen
Jeder Mensch hat individuelle Stärken und Schwächen. Gerade der Umgang mit den eigenen Unzulänglichkeiten ist ein Indikator für Ihre Natürlichkeit. Natürliche Menschen stehen zu Schwächen und gehen offen damit um. Andere überspielen und verstecken, um eine perfekte Fassade aufrechtzuerhalten.
-
Sie belügen sich selbst
Ein deutliches Anzeichen, dass Sie nicht Sie selbst sind: Sie belügen sich selbst. Wenn Sie eigene Entscheidungen verändern oder Ihr Verhalten anpassen, um anderen zu gefallen oder nur auf deren Ratschlag zu hören, machen Sie sich selbst etwas vor. Egal, wie oft Sie sich einreden, dass Sie hinter dem Verhalten stehen, letztlich werden Sie von außen beeinflusst. Mit Natürlichkeit hat das nichts mehr zu tun – Sie wollen es anderen recht machen und Erwartungen erfüllen.
Was andere dazu gelesen haben