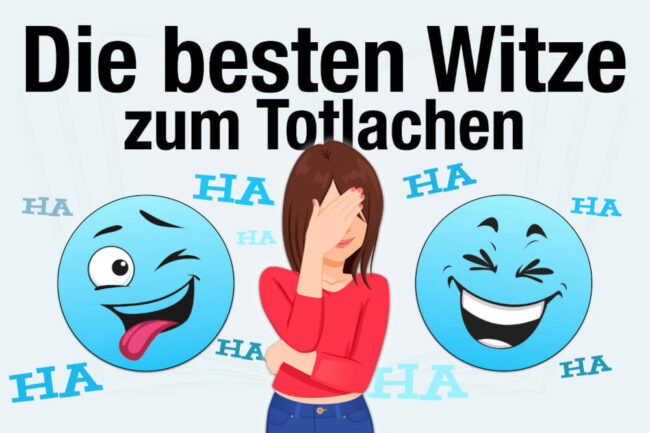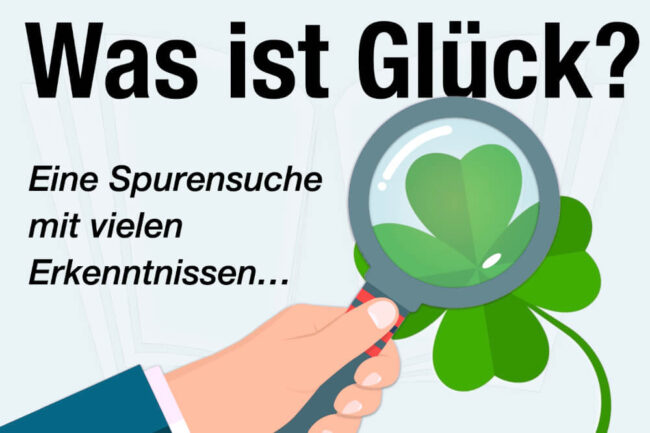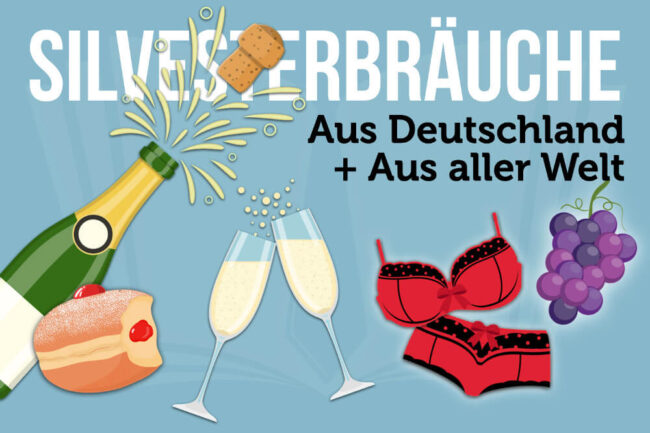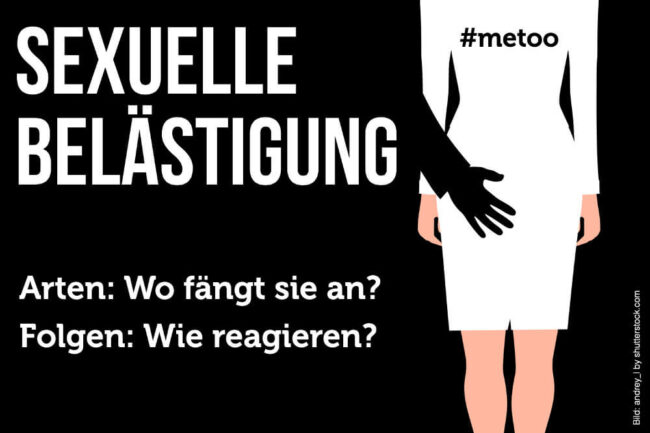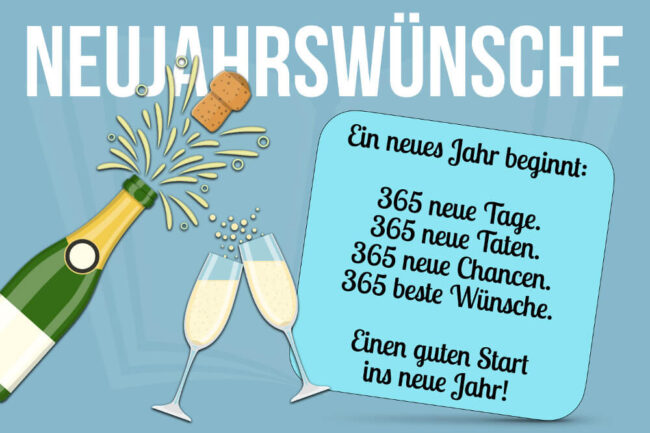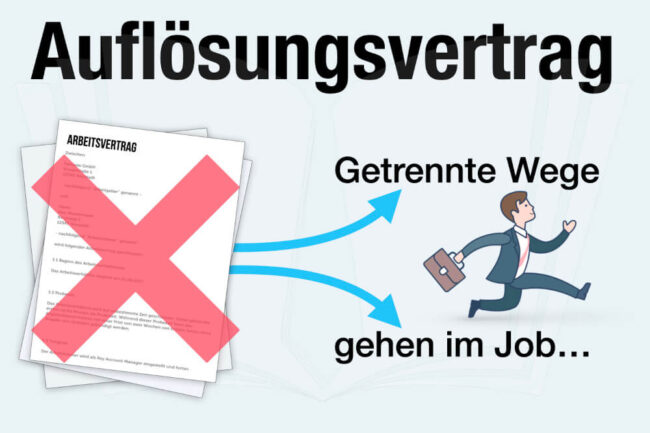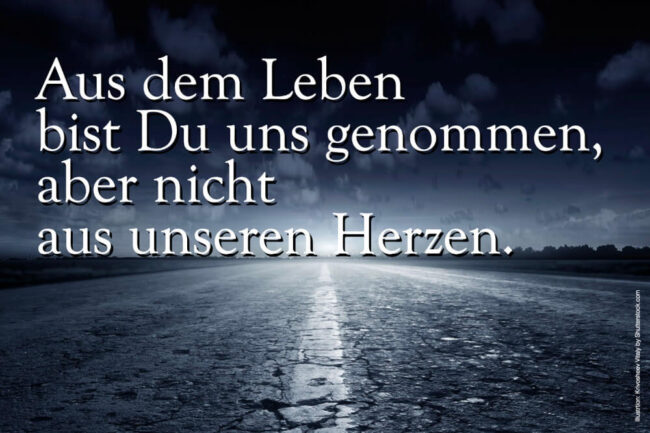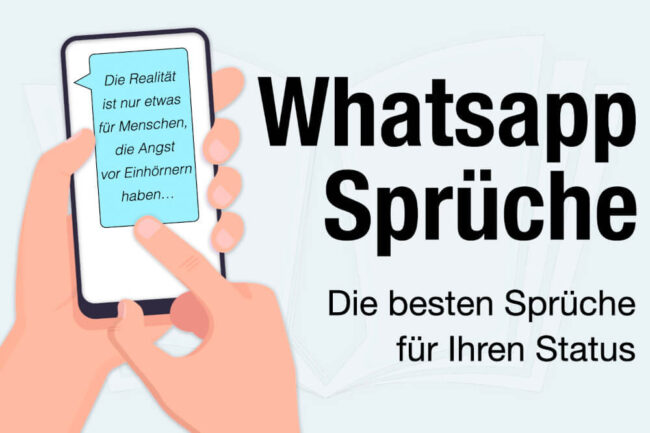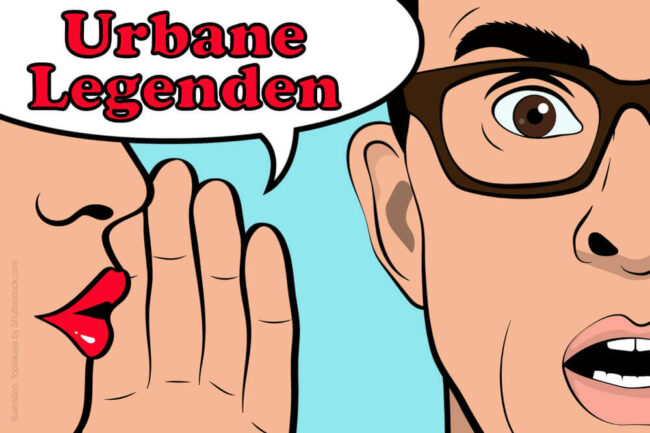Definition: Was ist Aberglaube?
Aberglaube (auch: Aberglauben) beschreibt einen Glauben an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte – bei Menschen, Tieren oder Dingen –, die sich auf das persönliche Glück oder Pech auswirken. Aberglaube hat nichts mit religiösem Glauben zu tun, weshalb er auch als der „falsche Glaube“ bezeichnet und mit Unvernunft und Naivität gleichgesetzt wird.
Wer abergläubisch ist, glaubt, dass bestimmte Gegenstände, Symbole oder Ereignisse als Glücksbringer wirken oder Unglück bringen – zum Beispiel ein vierblättriges Kleeblatt, Daumen drücken oder Freitag der 13. sowie schwarze Katzen von links.
Aberglaube Ursprung
Im Mittelalter hieß der Aberglaube noch „Afterglaube“ und wurde mit Hexerei, Ketzerei und Häresie in Verbindung gebracht. Er galt als abweichender, heidnischer Irrglaube und wurde bis ins 17. Jahrhundert von der Kirche verfolgt.
Aberglaube Synonyme
Häufige Synonyme für Aberglaube (engl. Superstition) sind: Geisterglaube, Gespensterglaube, Wunderglaube, Irrglaube, Volksglaube, Magie oder Mystizismus.
Aberglauben Beispiele: Was bringt Glück oder Pech?
Es gibt die unterschiedlichsten Formen von Aberglauben. Diese unterscheiden sich von Land zu Land und von Kultur zu Kultur. Im asiatischen Raum – insbesondere in China und Japan – ist der Aberglaube weit verbreitet. Dort gilt zum Beispiel die Zahl 4 als Unglückszahl. Das geht soweit, dass es in manchen Häusern keine 4. Etage gibt oder in Aufzügen auf den dritten Stock der fünfte folgt. Im europäischen Raum passiert dasselbe zum Teil mit der Zahl 13.
Eine Übersicht der populärsten Aberglauben, Glücksbringer und Pechboten…
Aberglaube Beispiele: Glücksbringer
Vierblättrige Kleeblätter
Kleeblätter gibt es viele – Glück bringen soll aber nur das vierblättrige Kleeblatt. Der Aberglauben basiert darauf, dass Klee mit vier Blättern in der Natur nur selten vorkommt. Es braucht also eine Menge Glück, um ein solches vierblättriges Kleeblatt zu finden. Laut religiösem Aberglauben, soll Eva ein vierblättriges Kleeblatt aus dem Paradies als Andenken mitgebracht haben.
Scherben
Wenn es sich nicht gerade um die Scherben eines Spiegels handelt (siehe unten), sollen Scherben Glück bringen. Besonders wenn es sich um Porzellan handelt. Deshalb wird zum Beispiel am „Polterabend“ vor einer Hochzeit besonders viel Porzellan für das Brautpaar zerbrochen, um eine lange und glückliche Ehe zu wünschen.
Auf Holz klopfen
Viele Menschen glauben, wer drei Mal auf Holz klopft, ruft das Glück herbei. Im Ruhrpott geht dieser Aberglaube auf Bergleute zurück, die durch Klopfen geprüft haben, ob die Holzträger unter Tage noch halten und von guter Qualität sind. Andere Überlieferungen sprechen von Seeleuten und Matrosen, die den Mast eines Schiffs abklopften, um zu untersuchen, ob das Holz noch hält. Heute ist der Aberglaube vor allem bei Theaterleuten und Schauspielern vor einem Auftritt verbreitet.
Schornsteinfeger
Einen Schornsteinfeger auf der Straße sehen, soll Glück bringen. Wer noch mehr Glück braucht, soll den Schornsteinfeger anfassen oder sogar küssen. Hinter diesem Aberglauben steckt ein wahrer Hintergrund: Früher sorgte der Schornsteinfeger mit seiner Arbeit dafür, die Brandgefahr von Häusern zu senken. Kam der Schornsteinfeger, wurde also tatsächlich potenzielles Unheil abgewendet.
Hufeisen
Weil Pferde schon immer ein Symbol für Kraft, Stärke und Reichtum waren und Hufeisen diese edlen Tiere schützen, gelten die Pferdeschuhe als Glücksbringer. Fand ein Bauer ein Hufeisen auf dem Feld, sollte ihm das Glück bringen und Haus und Hof beschützen. Das Hufeisen über der Tür soll wiederum dem Teufel auf den Kopf fallen, falls er dort eindringen will. Was die Ausrichtung des Hufeisens anbelangt gibt es unterschiedliche Aberglauben: Die einen sagen, die Öffnung muss nach oben, um das Glück einzufangen; andere glauben, sie gehört nach unten, damit sich das Glück verbreiten kann.
Salz über die Schulter werfen
Salz war früher enorm kostbar – es galt als weißes Gold, weil damit Lebensmittel haltbar gemacht werden konnten. Der Verlust von Salz war bereits ein Unglück. Wer es verschüttete, dem brachte es angeblich Streit. Wer es hingegen über die linke Schulter warf, sollte die Wirkung ins Gegenteil verkehren können und wieder Glück haben. Es sei denn, man traf damit seinen Hintermann ins Auge…
Sternschnuppen
Wer eine Sternschnuppe sieht, soll sich etwas wünschen, was dann in Erfüllung geht – aber nur, wenn man nicht verrät, was man sich gewünscht hat.
Regenbogen
Angeblich liegt am Ende eines Regenbogens ein Schatztruhe voller Gold vergraben. Der Aberglaube verrät allerdings nicht, an welchem Ende man zuerst graben sollte.
Glückspfennig
Der Glückspfennig, heute „Glückscent“ besteht aus Kupfer. Dem Metall wurde schon immer nachgesagt, es könne böse Zauber lösen. Deshalb wurde zum Beispiel früher zur Geburt ein kupferner Tauftaler verschenkt. Wer heute einen Cent auf der Straße findet, sollte ihn laut Aberglaube aufheben und als Glücksboten betrachten. Wer ihn verschenkt, dem bringt der Glückscent zudem finanzielles Glück.
Marienkäfer
Manche glauben Marienkäfer seien der Himmelsbote der Mutter Gottes (Maria). Laut Aberglaube beschützt der Nützling Kinder und heilt Kranke, wenn er ihnen zufliegt. Wer ihn aber abschüttelt oder gar tötet, dem bringt das großes Pech.
Das blaue Auge (Nazar)
Dieser Aberglaube ist in orientalischen Ländern weitverbreitet. Angeblich schützt das Amulett mit dem blauen Auge vor dem bösen Blick und bildet eine Art Gegenzauber. Dem Omen und Volksglauben nach sollen Menschen mit hellblauen Augen einen unheilvollen Blick haben. Ob das die Skandinavier wissen?
Winkekatze
Die Winkekatze haben Sie sicher schon in zahlreichen asiatischen Restaurants gesehen. Der Glücksbringer heißt offiziell „Maneki Neko“ und stammt ursprünglich aus Japan. Winkt sie mit der rechten Pfote, bedeutet das Wohlstand; winkt sie mit links, steht das für Glück. Die Winkekatze soll damit beides herbeiwinken. Im Zweifel auch nur die Kunden ins Restaurant oder Geschäft.
Aberglaube Beispiele: Unglücksbringer
Freitag der 13.
Für abergläubische Menschen ist das der schlimmste Tag der Woche: An einem Freitag den 13. geht alles schief, was schief gehen kann. Manche Menschen versuchen dem zu entgehen, indem sie an einem 13. möglichst nichts unternehmen, zuhause bleiben und auf keinen Fall wichtige Dinge auf dieses Datum legen. Übrigens: An Monaten, die mit einem Sonntag beginnen, gibt es IMMER einen Freitag den 13.
Einen Spiegel zerbrechen
Wer einen Spiegel zerbricht, soll angeblich 7 Jahre lang Pech haben. Begründung: Mit dem zerbrochenen Spiegelbild soll die Seele zu Bruch gehen und für das anstehende Unglück sorgen.
Unter Leitern durchgehen
Lehnt eine Leiter an der Wand, werden abergläubige Menschen nicht darunter durchgehen, sondern lieber einen kleinen Umweg und außen um die Leiter gehen. Wer unter einer Leiter hindurchgeht, soll das Böse magisch anziehen. Der Ursprung ist zwar ungeklärt. Davon abgesehen, könnte einem aber wirklich etwas auf den Kopf fallen.
Schwarze Katze
Wem eine schwarze Katze auf der Straße begegnet, der sollte laut Aberglaube auf die Richtung achten, von der sie kommt: Läuft die Katze von links nach rechts, bringt das Pech – überquert sie die Straße aber von rechts, soll das wieder Glück bringen. Warum? Weiß nur die Katze…
Frühzeitig gratulieren
Der Geburtstag eines Freundes steht an? Daran sollten Sie denken, aber laut Aberglauben nicht vor dem eigentlichen Tag gratulieren! Das soll Unglück bringen, weshalb viele Geburtstagskinder keine Glückwünsche hören wollen, bevor die Uhr nicht die erste Minute des Geburtstages verkündet.
Beim Anstoßen nicht in die Augen schauen
Gilt nicht nur für Liebespaare: Wer seinem Gegenüber beim Anstoßen und Zuprosten nicht in die Augen schaut, soll sieben Jahre lang schlechten Sex haben. Ist natürlich Blödsinn – aber Blickkontakt beim Anstoßen bleibt trotzdem eine höfliche Geste.
Krähen auf dem Dach
Krähen (teils auch Raben) gelten als Unheilsboten. Landet eine Krähe auf einem Hausdach, soll das ankündigen, dass ein Bewohner krank wird – so jedenfalls der Aberglaube. Den bösen Bann abwehren kann man dann nur durch dreimaliges Spucken. Ob in die Hände oder auf die Krähe, sagt der Aberglauben nicht.
Aberglaube aus aller Welt: Beispiele
Aberglaube ist ein internationales Phänomen. Aber woran glauben Menschen in anderen Ländern der Welt? Eine Übersicht und Auswahl mit Beispielen:
- 🇳🇱 Niederlande
Bei unseren Nachbarn bringt es angeblich Unglück beim Essen zu singen – das locke den Teufel an. - 🇳🇴 Norwegen
Bei schönem Wetter sollten Sie dort bloß nicht die Sonne anpfeifen. Sonst gibt es Regen. - 🏴 Schottland
Wer dort zu einer Hochzeit eingeladen wird, sollte nichts Grünes tragen – das bringt dem Paar laut Aberglaube Pech, weil man damit die Elfen verärgert. - 🇷🇺 Russland
Fällt ein Messer während des Essens vom Tisch, kommt bald ein Mann zu Besuch; fallen hingegen Gabel oder Löffen zu Boden, folgt Damenbesuch. - 🇪🇬 Ägypten
Hier sagt man beim Anblick eines Babys „Oh, wie hässlich!“ – angeblich, weil man die bösen Mächte nicht neidisch machen und das Kind gefährden will. - 🇻🇳 Vietnam
Im Haus sollte man keine Münzen in der Tasche tragen, weil man sonst nicht mehr wächst.
Psychologie: Warum gibt es Aberglaube?
Hinter jedem Aberglauben verbirgt sich letztlich die Vermutung, dass es unsichtbare (okkulte) Mächte gibt, die unser Leben beeinflussen. Es ist der Glaube an unerklärbare, magische Kräfte, die über den Naturgesetzen stehen.
Abergläubische Praktiken sollen dann einerseits potenzielles Unglück, Schäden, Gefahren, Krankheit und Tod abwehren und gleichzeitig mehr Glück, Gesundheit oder Reichtum herbeizaubern. Dazu reichen manchen auch einfach Symbole und Gegenstände im Alltag: eine Kette am Handgelenk, ein Ring mit einem Halbedelstein, ein Anhänger oder Foto von einem Heiligen und Schutzpatron als persönlicher Glücksbringer.
Aberglaube ist oft Privatsache
Der Aberglaube ist verbreiteter als viele meinen. Trotz Aufklärung hält er sich hartnäckig in den Köpfen. Nicht zuletzt, weil sich die Menschen gerne an ein Stück Hoffnung klammern. Nur sprechen nicht alle offen über die Hasenpfote am Schlüsselanhänger oder ihre angeblichen Glückszahlen vor der nächsten Lottoziehung.
Aus Sicht der Psychologie ist aber klar: Je unsicher die Menschen sind, je ohnmächtiger sie sich fühlen, desto abergläubischer werden sie und versuchen das Heil wenigsten mithilfe von Glücksbringern zu beeinflussen. Es ist der Versuch, wenigstens ein bissch mehr Kontrolle zurückzugewinnen.
Aberglaube und Confirmation Bias
Hinter dem Aberglaube verbirgt sich oft der sogenannte Confirmation Bias – auf deutsch: Bestätigungsfehler. Er besagt, dass wir unbewusst nach Informationen suchen, die unsere Annahmen bestätigen. Wer also zum Beispiel glaubt, dass ein Freitag der 13. Pech bringt, wird nach unglücklichen Pannen besonders aufmerksam suchen – und sie auch finden. Die abergläubische Annahme wird so zur selbsterfüllenden Prophezeiung – auch wenn an diesem Tag nicht mehr oder weniger schiefgeht als sonst.
Wie beeinflusst uns der Aberglaube?
Um es klar zu sagen: Wir glauben nicht an Humbug, Omen, Unglück- und Glücksbringer. Gleichzeitig lässt sich nicht verleugnen, dass Aberglaube Wirkung hat – nur anders als gedacht. Eine Kölner Studie konnte zum Beispiel zeigen, dass Glücksbringer tatsächlich die Leistung von einigen Menschen steigern: In den Experimenten dazu sollten die Teilnehmer Golf spielen. Wer einen Glücksbringer mitbrachte, an den er fest glaubte, erzielte signifikant bessere Ergebnisse als jene, die ihren Talisman vorher ablegen mussten.
Andere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass mehr als ein Drittel der Menschen an irgendwelche Glücksbringer – mehr oder weniger intensiv – glauben. Damit beeinflussen diese bereits ihre Verhalten, ihren Selbstglauben und manche Entscheidung (siehe: Gesetz der Anziehung).
Im Positiven kann der Glaube an das eigene Glück selbstbewusster machen. Im negativen Extrem kann er ebenso blockieren oder zum Beispiel in eine Spielsucht führen. Glück oder Pech? Am Ende ist das eine Frage der eigenen Haltung und Einstellung zum Leben…
Was andere dazu gelesen haben