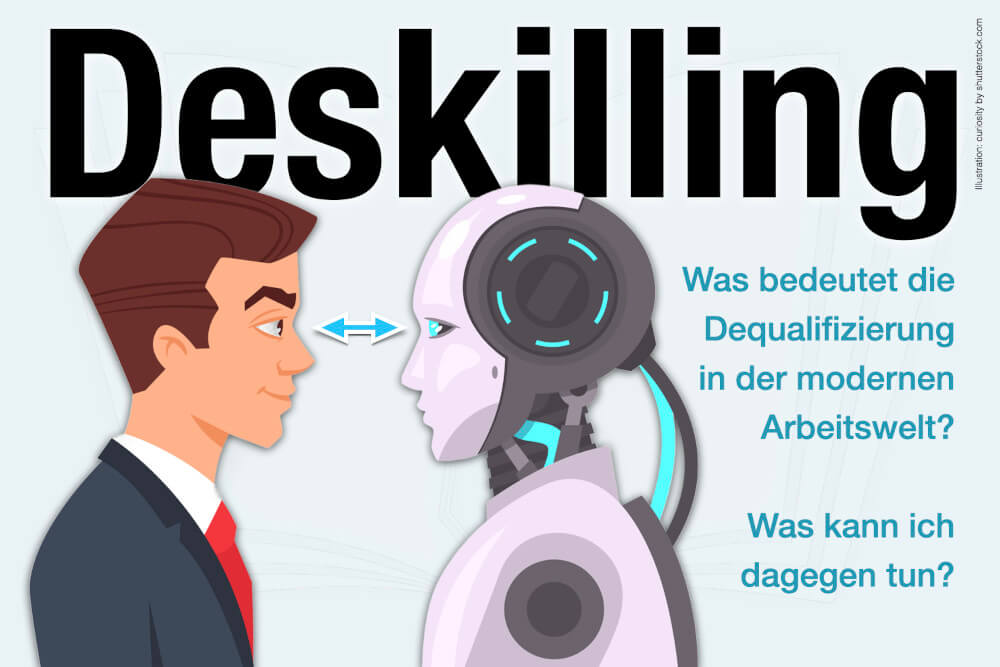Definition: Was bedeutet Deskilling?
Deskilling (Deutsch: Dequalifizierung) bezeichnet den Verlust oder die Entwertung von wichtigen Fähigkeiten und Kompetenzen für einen Beruf oder die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit aufgrund von Arbeitsprozessveränderungen oder neuer Technologien wie KI.
Weil Fachwissen immer schneller veraltet und manche Jobs sowie Menschen immer leichter von Maschinen oder Künstlicher Intelligenz ersetzt werden, sorgt Deskilling für einen dramatischen Arbeitsmarktwandel (siehe: WEF-Studie), insbesondere bei Jobs mit niedriger Qualifikation oder kreativen Berufen.
Woher stammt der Begriff Deskilling?
Der Begriff „Deskilling“ stammt aus der Arbeitssoziologie und beschreibt zwei Perspektiven:
-
Soziologie
In der Soziologie beschreibt Deskilling einen Kompetenzverlust in der Gesellschaft, wenn bestimmte Fähigkeiten nicht mehr benötigt oder entwickelt werden, weil Technologien diese übernehmen.
-
Arbeitspsychologie
Für den Einzelnen bedeutet Deskilling das Entwerten und Verlernen von Know-how oder sozialen Fähigkeiten, weil diese immer seltener praktiziert werden. Etwa weil Menschen kaum noch zusammenarbeiten und nur von zuhause arbeiten.
Beispiele für Deskilling in der modernen Arbeitswelt
In der modernen Arbeitswelt gibt es inzwischen zahlreiche Beispiele für Deskilling, vor allem in Verbindung mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung:
-
Medizin
In der Diagnostik kann der Einsatz von KI dazu führen, dass Ärzte weniger routiniert sind, weil KI die Erkennung von Krebs und anderen Krankheiten unterstützt oder gar ersetzt. Verlassen sich Ärzte zu sehr auf die Software, gehen ihre eigenen Fertigkeiten verloren.
-
Kontrollaufgaben
Viele Tätigkeiten, die bisher qualifizierte Fachkenntnisse erforderten, sind heute automatisiert und benötigen nur noch die Kontrolle oder Überwachung durch den Menschen. So werden z.B. Produktionsprozesse oder Datenanalysen von KI übernommen. Dadurch geht manch anspruchsvolle Arbeit verloren.
-
Büro- und Verwaltungsarbeit
KI-Tools übernehmen zunehmend Schreib-, Kalkulations- oder Verwaltungsaufgaben, was die Notwendigkeit bestimmter Fachkenntnisse reduziert. Dies kann dazu führen, dass sich Mitarbeiter mit diesen Kompetenzen nicht weiterentwickeln oder sogar arbeitslos werden.
-
Automobilbranche
Durch den Wandel von Verbrennungs- zu Elektromotoren verlieren viele Mitarbeiter spezifisches technisches Wissen, müssen umgeschult werden (sog. Reskilling) oder verlieren sogar ihre Jobs – etwa bisherige Getriebeingenieure.
Diese Beispiele zeigen insgesamt, wie der technologische Fortschritt einerseits zur Produktivität und Effizienz beiträgt, jedoch auf der anderen Seite menschliche Fähigkeiten im Berufsalltag verringert oder diese gar durch Maschinen ersetzt und die Arbeit entwertet.
Welche Branchen oder Berufe sind besonders betroffen?
Deskilling betrifft zwar längst nicht alle Branchen und Berufe, einige aber mehr als andere. Betroffen sind vor allem Routine- und standardisierte Tätigkeiten sowie einige kreative Tätigkeiten:
Branchen & Bereiche |
Berufsbilder |
| Produktion | Grafikdesigner |
| Entwicklung | Ingenieure |
| Verwaltung | Synchronsprecher |
| Gesundheitswesen | Fotografen |
| Transport & Logistik | Texter |
| Einzelhandel | Makler |
Was sind die Ursachen für Deskilling?
Die Ursachen für Deskilling sind vielfältig und eng mit technologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklungen verbunden. Zu den wichtigsten Faktoren für Deskilling gehören:
-
Technologischer Fortschritt
Automatisierung und insbesondere der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) übernehmen zunehmend komplexe Tätigkeiten, wodurch die Anforderungen an menschliche Fähigkeiten sinken. Wenn Aufgaben von Maschinen ausgeführt werden, verkümmern oft die entsprechenden Kompetenzen der Menschen, da sie nicht mehr praktiziert werden.
-
Organisatorische Veränderungen
Durch Digitalisierung und Restrukturierungen werden Arbeitsprozesse häufig vereinfacht, standardisiert oder fragmentiert, sodass Mitarbeiter nur noch eingeschränkte, repetitive Tätigkeiten ausführen. Die digitale Transformation engt damit die Handlungsspielräume ein und führt zum Kompetenzverlust.
-
Ökonomische Faktoren
Kostendruck und Effizienzsteigerungen führen zu Stellenabbau und zugleich steigender Arbeitsverdichtung bei den verbleibenden Kräften. Dies fördert Deskilling, da weniger Ressourcen für Weiterbildung und Personalentwicklung zur Verfügung stehen oder viele Arbeitskräfte psychisch erschöpft sind.
-
Demografischer Wandel
Die sinkende Zahl an Nachwuchskräften und der gleichzeitige Ruhestand vieler älterer und erfahrener Fachkräfte führen zum Fachkräftemangel. Umschulungen und Qualifizierungsmaßnahmen sind oft herausfordernd, kostenintensiv und können das nur teilweise ausgleichen, was Deskilling begünstigt.
-
Systemische Ungleichheiten
Deskilling ist zudem ein Symptom struktureller Ursachen sowie eines ökonomischen Wandels, der durch Automatisierung die Macht und Vorteile immer stärker auf große Unternehmenseinheiten bzw. Unternehmereliten konzentriert (Tendenz zu Oligopolen und Monopolen).
-
Fehlende Weiterbildung
Teilweise liegen die Ursachen auch bei den einzelnen Arbeitnehmern: Unzureichende oder fehlende Fortbildung (siehe: lebenslanges Lernen) fördern ebenfalls die Dequalifizierung. So groß die Begeisterung für KI ist: Viele Nutzer sägen dabei am Ast auf dem sie sitzen und lassen zu, dass Sie mehr verlernen als dazuzulernen.
Verringert KI unsere Kompetenzen im Beruf?
Jüngste Studien weisen darauf hin, dass KI zu einer Verringerung der beruflichen Kompetenzen führen kann. Die künstliche Intelligenz übernimmt zunehmend nicht nur Routineaufgaben, sondern eben auch komplexe Tätigkeiten, wodurch Mitarbeitende bestimmte Fähigkeiten verlernen oder sogar regelrecht „dümmer“ werden. Besonders betroffen sind Bereiche, in denen Menschen stark auf die Unterstützung von KI vertrauen und ihre eigenen Fertigkeiten dadurch weniger trainieren.
Was kann ich gegen Deskilling tun?
Gegen Deskilling kann jeder selbst aktiv vorgehen, indem er oder sie gezielte Fortbildungen nutzt sowie permanent in seine Kompetenzentwicklung – sogenanntes Upskilling – investiert. Wichtige Strategien dazu sind:
-
Upskilling & Reskilling
Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen und die gezielte Erweiterung vorhandener Fähigkeiten sowie Reskilling, also das Auffrischen wichtiger Qualifikationen helfen, sich an technologische Veränderungen anzupassen und relevante Kompetenzen aufzubauen.
-
Hybride Arbeit fördern
Verlassen Sie sich einfach auf künstliche Intelligenz oder lassen Sie sich von KI nicht vollständig die Arbeit abnehmen. Nutzen Sie diese hingegen klug zur Unterstützung oder binden Sie diese in Lernprozesse ein, aber reflektieren Sie auch weiterhin kritisch Ihre Aufgaben und Ergebnisse.
-
Medienkompetenz entwickeln
Automatisierung und KI gehen nicht mehr weg. Umso wichtiger ist, dass Sie Ihre Techniknutzung und KI-Informationen kritisch hinterfragen. Glauben Sie nicht alles! Eine ausgeprägte Medienkompetenz – schon bei Kindern und Jugendlichen – ist schon heute ein bedeutender Baustein, um dem Deskilling entgegenzuwirken und sich weniger von Technik oder Deep Fakes steuern zu lassen.
-
Lernfreundliche Arbeitskultur schaffen
Bildung ist in Deutschland nicht nur Ländersache. Auch Unternehmen sollten eine Arbeitsumgebung schaffen, die das Lernen während der Arbeit mit ausreichend Zeit und Ressourcen fördert. Sprechen Sie mit Ihrem Chef und fragen Sie nach Rahmenbedingungen, die das lebenslange Lernen zielgruppengerecht ermöglichen und fördern.
Die genannten Maßnahmen wirken zusammen, um wichtige Kompetenzen nicht zu verlieren und dem Deskilling vorzubeugen. Die bewusste Kombination von menschlicher Lernaktivität und unterstützender KI wird heute von vielen Wissenschaftlern als vielversprechender Ansatz angesehen.
Was andere dazu gelesen haben