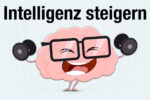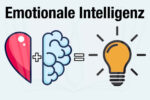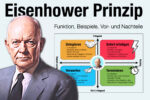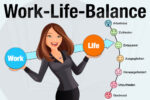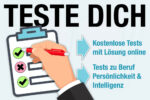Definition: Was ist eine Schuldfrage?
Die Schuldfrage ist die Frage nach der Verantwortung oder Verfehlung eines Angeklagten bzw. Beschuldigten. Ob Schuld oder Unschuld – darüber entscheiden in der Regel die Richter vor Gericht.
Schuld ist ein Begriff aus dem Bereich der Ethik und des Strafrechts. So kann jemand Schuld haben, indem er die Interessen einer anderen Person vorsätzlich verletzt. Ebenso kann sich jemand schuldig machen, wenn er oder sie eine notwendige Handlung oder Hilfeleistung unterlässt. Überdies gibt es eine moralisch Schuld – zum Beispiel für fehlende Dankbarkeit.
Was ist die Schuldfrage im Job?
Auch im Job kann vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten zu einer Schuld führen. Die Folgen bei kapitalen Fehlern können von Abmahnung und Kündigung bis zu Haftung und Schadensersatz reichen.
Die Schuldfrage bzw. die Suche nach einem Schuldigen führt im Job jedoch häufig dazu, dass die Verursacher oder Täter alles abstreiten, sich rechtfertigen und Verantwortung delegieren oder eigenes Versagen verschleiern und verheimlichen. Die Folgen sind Ausflüchte, Ausreden oder gar Betrug.
Es entsteht der sogenannte Teufelskreis der Problemfokussierung:
Leider verkommt die Schuldfrage in vielen Unternehmen zu einer Art Hexenjagd. Das Ergebnis ist jedoch eine Unternehmenskultur des Misstrauens, der Risikoaversion und sinkenden Innovationskraft.
Was tun gegen die Jagd nach dem Schuldigen?
Je nach Kontext und Ausmaß des Schadens, ist die Schuldfrage und Analyse der Ursachen natürlich nicht unwichtig. Beiden sind Teil der Problemlösung – auch und gerade für die Zukunft.
Genau das macht bei der Schuldfrage den Unterschied: der konstruktive Blick nach vorn. Wie konnte es dazu kommen? Wie kriegen wir das wieder hin? Wie können wir es künftig besser machen? Indem Führungskräfte nicht die Schuld und den Sündenbock in den Vordergrund stellen, sondern die potenzielle Lektion und den Erkenntnisgewinn, lösen sie sich von einer Angstkultur und setzen ein wichtiges Signal: „Wir alle machen Fehler, niemand ist unschuldig – aber wir müssen daraus lernen!“ (siehe: Trial and Error).
Denken Sie an den IBM-Gründer Tom Watson: Als einer seiner Mitarbeiter einen schweren Fehler beging, kostete der das Unternehmen 600.000 Dollar. Daraufhin fragte man Watson, ob er den Mitarbeiter nicht feuern wolle, was Watson vehement verneinte. Er sagte nur: „Ich habe gerade 600.000 Dollar in seine Ausbildung investiert. Warum sollte jemand anderes dieses Know-how gratis bekommen?“
Wie sollte ich auf die Schuldfrage reagieren?
Ist Ihnen ein Missgeschick unterlaufen, sollten Sie in jedem Fall Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen. Wem wir die Schuld geben, dem geben wir auch die Macht. Bedeutet: Wer Schuld delegiert, macht sich immer klein und schlüpft in die Opferrolle.
Eine professionelle Selbsterklärung erläutert klar und nachvollziehbar, welche Gründe es für das Fehlverhalten gab – jedoch ohne Ausflüchte und ohne sich zu rechtfertigen und beweist dadurch Rückgrat.
Langfristige Ent-Schuldigung
Fehler einzugestehen, ist nicht leicht. Es kratzt am Ego und der Selbstwahrnehmung. Auch haben viele Angst vor möglichen Sanktionen. Insofern ist ein offener Umgang mit Scheitern und Versagen auch ein Zeichen einer positiven Fehlerkultur.
Die Schuldfrage klären, führt aber langfristig zu einer Entschuldigung im Wortsinn. Wird damit konstruktiv umgegangen, profitieren am Ende alle davon: Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Was andere dazu gelesen haben