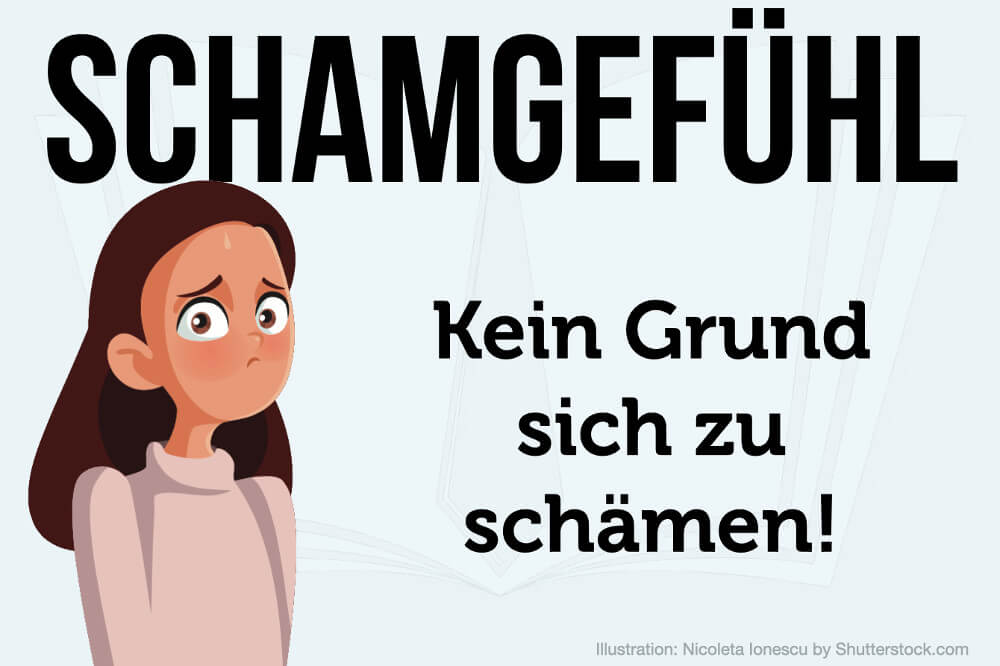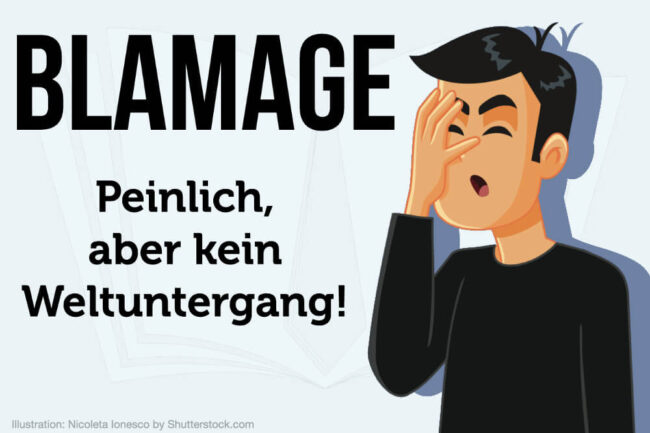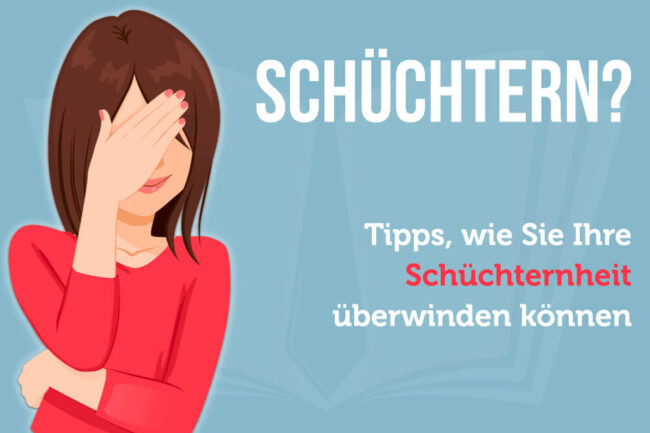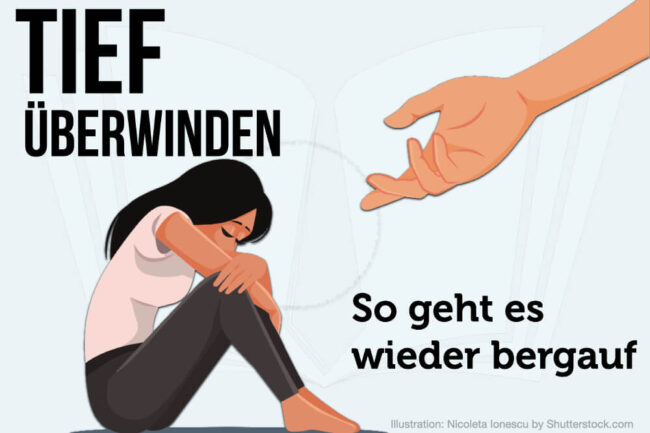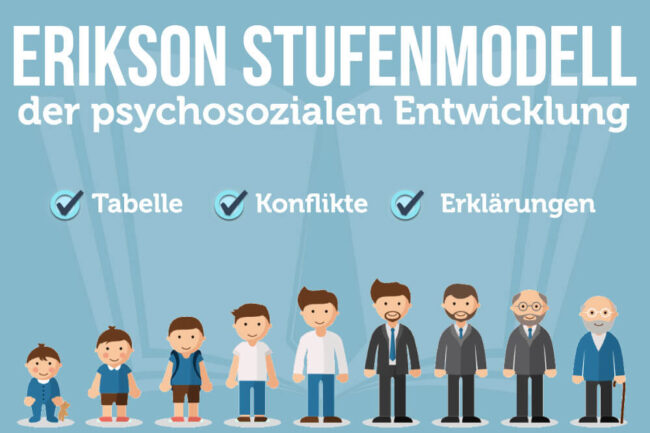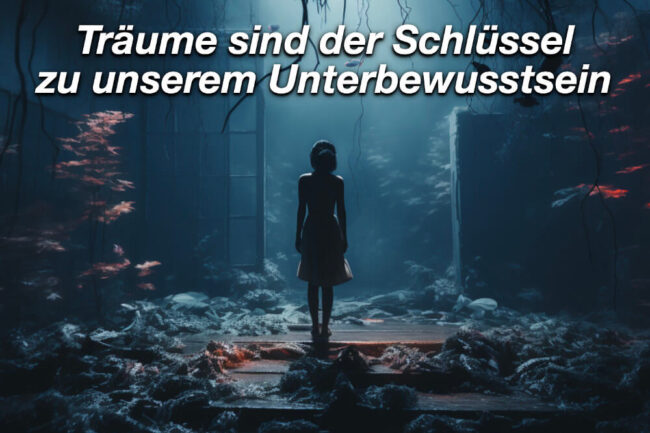Definition: Was bedeutet Schamgefühl?
Schamgefühl ist die Empfindung von Peinlichkeit und Bloßstellung. Es tritt auf, wenn man möchte, dass andere etwas nicht sehen, hören oder wissen sollten. Die Situation ist Betroffenen unangenehm und man fühlt sich vor dem Umfeld blamiert oder von anderen verspottet.
Bekannte Bereiche von Schamgefühl sind Nacktheit und die eigene Intimsphäre. Doch können Menschen in jeden Bereich des Lebens Scham empfinden. Immer, wenn man befürchtet, von der Norm abzuweichen und dafür von anderer zurückgewiesen zu werden, kann die Schamesröte ins Gesicht steigen.
Schamgefühl Synonym
Synonym zum Schamgefühl sind die Begriffe Verlegenheit, Unsicherheit, Befangenheit, Zurückhaltung oder kurz Scham. Auch „sich genieren“ und „peinlich berührt sein“ sind Ausdrücke für Menschen, die sich schämen.
Symptome: Wie zeigt sich Schamgefühl?
Schamgefühl spüren Sie im ganzen Körper. Die gesamte Situation ist Ihnen unendlich peinlich und Sie wollen am liebsten im Erdboden versinken. Typische Symptome dabei sind:
- Erröten
- Schweißausbrüche
- Zittern
- Schwindel oder Übelkeit
- Akute Kopfschmerzen
- Zu Boden schauen oder unsicheres Umherblicken
- Gefühlte Hilflosigkeit
- Angstzustände oder Panikattacke
Schamgefühl ist nicht angeboren
Schamgefühl ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft und schon bei kleinen Kindern ausgeprägt. Allerdings ist es nicht angeboren. Kleinkinder entwickeln ein Gefühl von Scham in den ersten zwei bis drei Lebensjahren. Dabei zeigen sie typische Signale wie ein gerötetes Gesicht, einen gesenkten Blick und eine zusammengesackte Körperhaltung. Einige Forscher gehen davon aus, dass das erste Schamgefühl als Reaktion auf Ärger oder Ekel der Eltern auf das Verhalten des Kindes entsteht.
Ursachen: Was löst Schamgefühl aus?
Hinter dem Schamgefühl steht ein vor anderen gezeigtes Fehlverhalten oder ein (unangenehmes) Abweichen von den Erwartungen oder der gesellschaftlichen Norm. Betroffene schämen sich für die öffentliche Bloßstellung und haben Angst vor den sozialen Konsequenzen – ausgelacht und verspottet werden oder von einer Gruppe ausgeschlossen werden.
Ursachen von Scham sind Situationen, die Betroffenen peinlich sind und von denen man sich wünscht, andere würden sie nicht bemerken. Ein wichtiger Faktor dabei ist die Bloßstellung. Typische Auslöser sind zum Beispiel:
- Öffentliche Fehler
- Nacktheit
- Kritik am eigenen Verhalten
- Falsche Entscheidungen
- Nicht erfüllte Erwartungen
- Aufgeflogene Lügen
- Von der Norm und gesellschaftlichen Werten abweichendes Verhalten
Voraussetzungen für Schamgefühl
Grundvoraussetzung für Schamgefühl ist ein Empfinden für Werte und Normen. Wie Kinder erste Scham aufgrund des Verhaltens der Eltern entwickeln, schämen sich auch Erwachsene nur, wenn Ihnen das Fehlverhalten oder die Abweichung von gesellschaftlichen Erwartungen bewusst ist. Das ist auch der Grund, warum manche Menschen weniger oder fast kein Schamgefühl besitzen (siehe: Soziopath). Ihnen fehlen internalisierte Werte – oder sie ignorieren diese bewusst. Das geschieht beispielsweise, um andere bewusst zu schockieren und im Mittelpunkt zu stehen. Regel- und Tabubrüche sind eine gezielte Methode zur Steigerung der Aufmerksamkeit.
3 Arten von Schamgefühl
Schamgefühl fühlt sich immer ähnlich an und führt zu denselben Reaktionen – es lassen sich aber verschiedene Arten unterscheiden. Differenziert werden dabei verschiedene Auslöser und Bereiche, in denen die Scham auftritt:
- Akute Scham
Die Tür zur Umkleidekabine wird aufgerissen, obwohl Sie noch halb nackt sind oder Sie vergessen bei Ihrem Vortrag vor 25 Kollegen, was Sie sagen wollten – akute Scham tritt durch plötzliche und unerwartete Situationen auf. Sie können sich nicht darauf vorbereiten. Das Gefühl entsteht innerhalb weniger Augenblicke. - Körperliche Scham
Betroffene tragen körperliche Scham ständig mit sich herum. Sie fühlen sich nicht schön oder schlank genug und wollen nicht, dass andere ihren Körper sehen. Diese Art führt zu Vermeidungsverhalten. Im Bikini ins Schwimmbad gehen? Bei ausgeprägter körperlicher Scham ist das für Betroffene keine Option. - Emotionale Scham
Viele Menschen empfinden die eigenen Emotionen als beschämend. Gerade öffentlich gezeigte Emotionen fallen Betroffenen dabei schwer. Sie schämen sich für ihre Trauer und Tränen, aber im Nachhinein auch für Wutanfälle oder andere Gefühlsausbrüche.
Schamgefühle treten auch auf, wenn wir unangenehmes Verhalten anderer Menschen beobachten. Dieser Fremdscham tritt etwa auf, wenn sich jemand vor uns blamiert oder sich öffentlich zum Deppen macht. Typisch ist Fremdscham etwa bei Reality-Shows und anderen TV-Formaten, bei denen Teilnehmer gezielt in peinliche und absurde Situationen gebracht werden.
Vorteile: Die guten Seiten des Schamgefühls
Wenn Sie sich gerade so richtig schämen, können Sie vermutlich keine Vorteile daran erkennen. Tatsächlich hat Schamgefühl aber gleich mehrere wichtige Funktionen und gute Seiten:
- Es ist ein Schutzmechanismus
Ohne Schamgefühl bringen Sie sich in unangenehme und schädliche Situationen. Sie fallen durch Fehlverhalten negativ auf und schaden Ihrem Ruf oder Ihrer Karriere – oder Sie tragen Privates in die Öffentlichkeit, obwohl es niemanden etwas angeht. Ihre Scham ist ein wichtiger Schutzmechanismus. - Es reduziert Strafen und Konsequenzen
Scham zeigt Schuldbewusstsein und Reue. Andere verzeihen Ihnen leichter, wenn Sie sich für einen Fehler schämen. Mögliche Strafen fallen insgesamt geringer und milder aus. - Es schafft Zugehörigkeit
Menschen in einer Gesellschaft schämen sich für ähnliche Dinge. Das Gefühl sorgt somit für Zugehörigkeit in einer sozialen Gruppe. Es zeigt, dass Sie Normen und Erwartungen teilen und vom Umfeld akzeptiert werden. - Es macht sympathisch
Zu sehen, wie sich jemand schämt, sorgt für große Sympathie und Mitgefühl. Wir versetzen uns in die Situation, fühlen uns verbunden und wollen dem Betroffenen helfen.
Vorsicht vor falscher und krankhafter Scham
Manche Menschen könnten ein wenig mehr Schamgefühl vertragen. Doch gibt es trotz der genannten Vorteile auch Probleme mit zu viel Scham. Betroffene von krankhaften Schamgefühlen schämen sich für fast alles, zusätzlich leiden sie oft unter Minderwertigkeitsgefühlen und anderen psychischen Erkrankungen.
Falsche Scham zeigt sich in Situationen, für die Sie sich gar nicht schämen müssen oder sollten. Sie schämen sich etwa im Job für eine Leistung, obwohl diese gut war oder Sie geraten bereits in Verlegenheit, wenn Sie im Meeting etwas sagen sollen. Damit stehen Sie sich selbst im Weg, blockieren Fortschritt und Erfolg.
5 Tipps, wie Sie Schamgefühle überwinden
Schamgefühl lässt sich nicht verhindern und sollte auch nicht unterdrückt werden. Schämen Sie sich aber zu stark, können Sie etwas dagegen tun. Diese fünf Tipps helfen, um Ihr Schamgefühl zu überwinden und zu reduzieren:
-
Machen Sie sich weniger Sorgen
Wir schämen uns, weil scheinbar alle Anwesenden unsere Peinlichkeit beobachten und wir öffentlich lächerlich gemacht werden. Falsch! Das Umfeld reagiert meist empathisch und positiver, als Sie glauben – und viele bekommen es gar nicht mit (siehe: Spotlight-Effekt). Sie stehen nicht im Rampenlicht, weil andere Menschen mit ihren eigenen Problemen und Gedanken beschäftigt sind.
-
Sprechen Sie mit Freunden und Familie
Ein offenes Gespräch mit Freunden oder Ihrer Familie kann Ihre Schamgefühle mildern. Sprechen Sie an, wofür Sie sich schämen und welche Probleme Sie damit haben. Es fällt schwer, doch wenn Sie darüber sprechen, können Sie das Gefühl besser verarbeiten. Zusätzlich hilft Ihnen der Zuspruch, den Sie von anderen bekommen.
-
Akzeptieren Sie Ihr Schamgefühl
Es ist weder schlecht noch unnormal, wenn Sie manchmal vor Scham im Boden versinken möchten. Die Empfindung ist nur menschlich und zeigt, dass Sie ein gutes Gespür für Werte und Erwartungen anderer Menschen haben. Akzeptieren Sie Ihre Scham als das, was sie ist: eine normale Reaktion Ihres Körpers auf bestimmte Situationen.
-
Arbeiten Sie an Ihrem Selbstvertrauen
Je größer Ihr Selbstvertrauen, desto leichter können Sie mit beschämenden Situationen umgehen. Sie kümmern sich weniger um die Meinung anderer Menschen und haben die Selbstsicherheit, in einer peinlichen Situation entspannt zu bleiben.
-
Lachen Sie einfach darüber
Die vielleicht beste Methode, um Ihr Schamgefühl zu überwinden, sind Humor und Selbstironie. Wenn Sie über sich selbst lachen können, vergeht die Peinlichkeit in kürzester Zeit und Sie nehmen es einfach mit Humor.
Was andere dazu gelesen haben