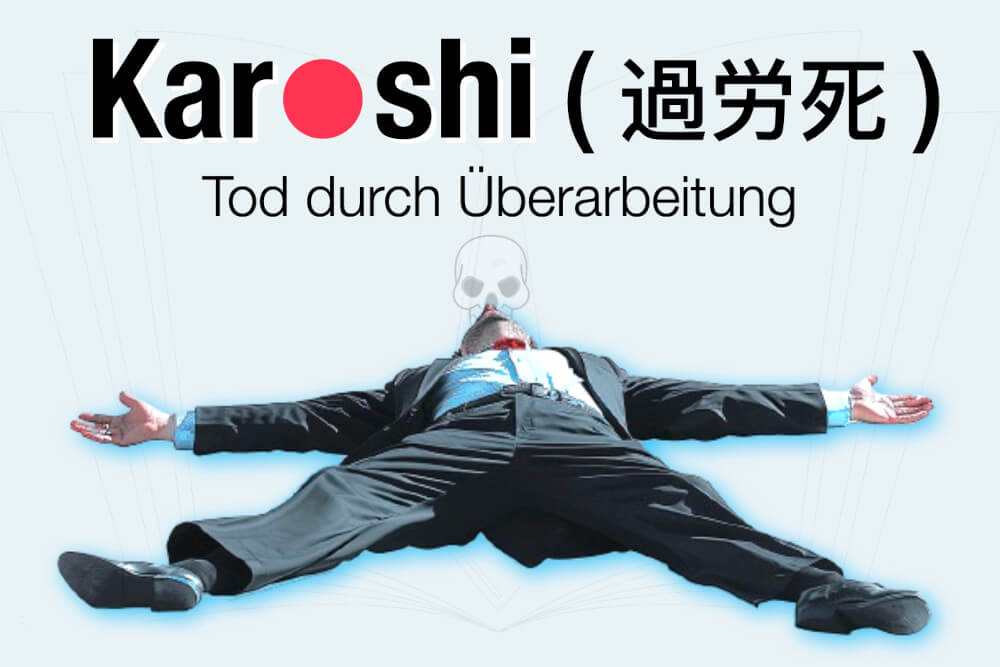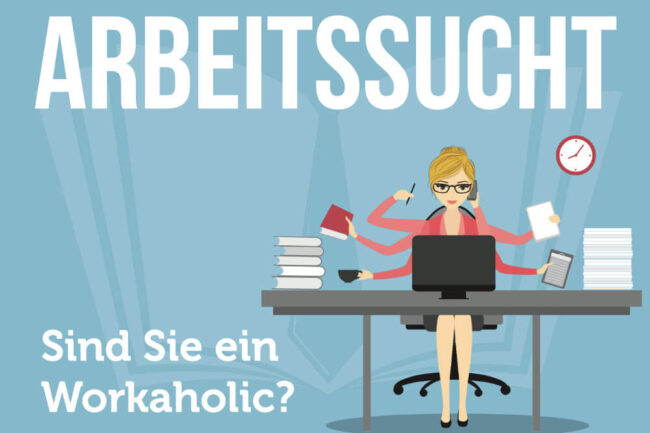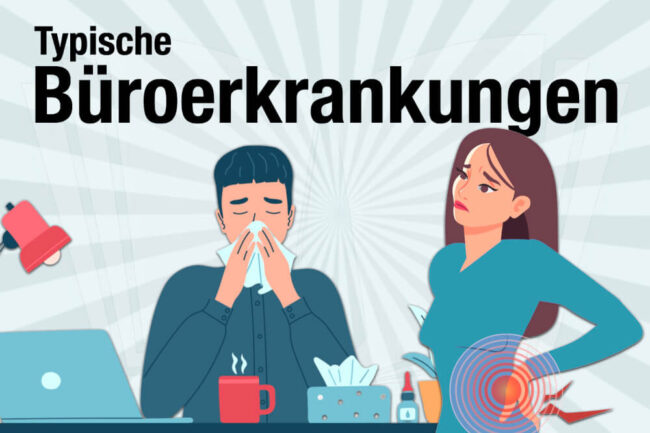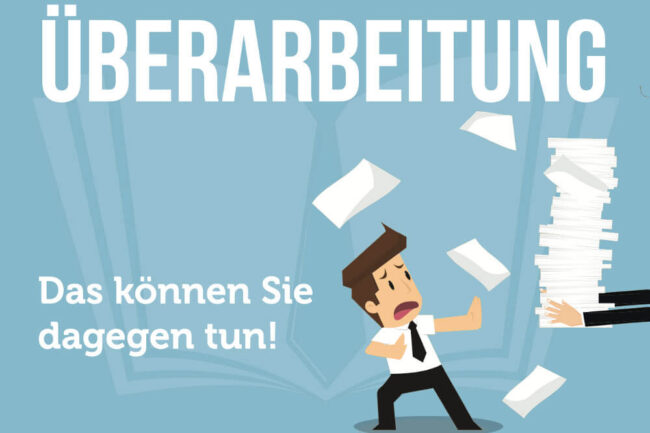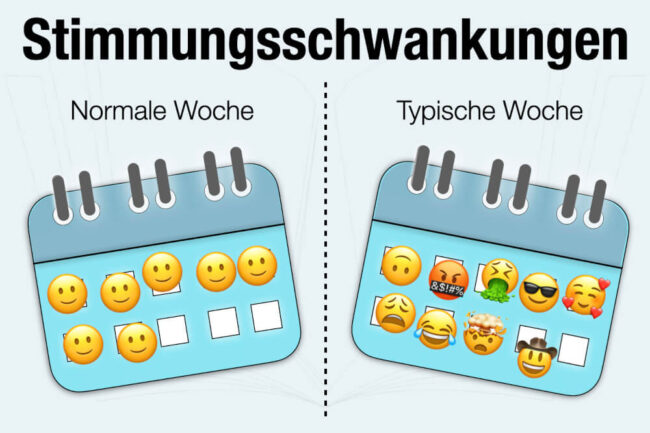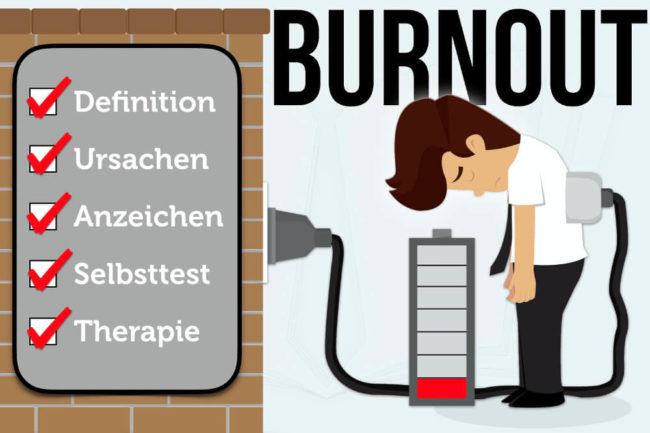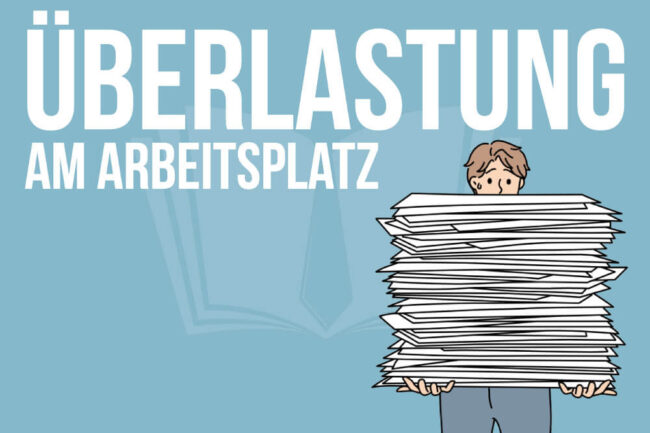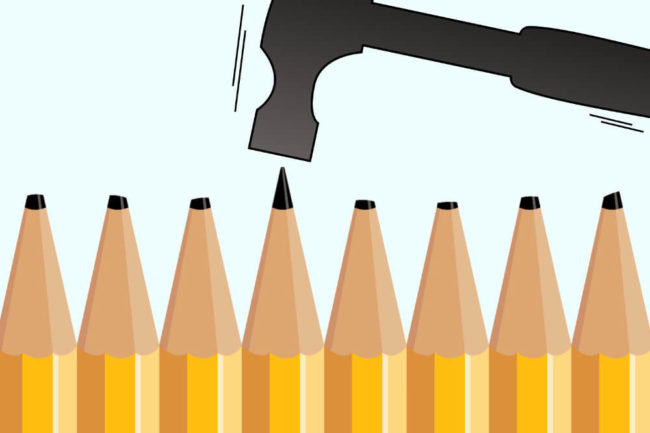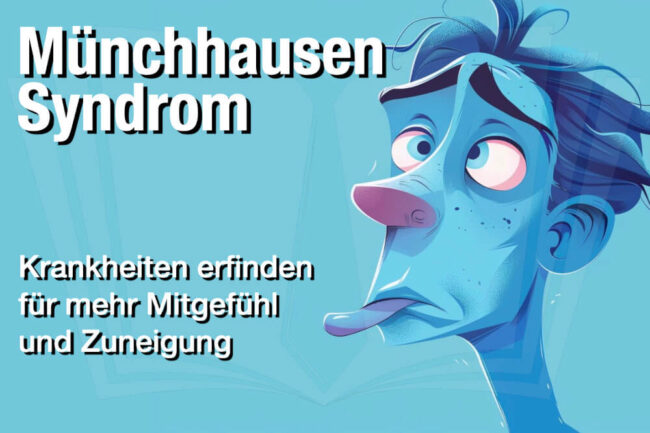Bedeutung: Was ist Karoshi?
Der japanische Begriff Karoshi (Aussprache: Karo Schi) bezeichnet den plötzlichen Tod durch Überarbeitung. Die Todesursache ist meist ein durch Stress ausgelöster Herzinfarkt oder Schlaganfall. Seltener sind Suizide, die auf arbeitsbedingte psychische Erkrankungen zurückgehen. Es ist auch umstritten, ob diese unter die Karoshi Definition fallen.
Der erste bekannte Karoshi-Fall stammt aus dem Jahr 1969. Seitdem wächst die Zahl stetig. Erst 2013 wurde eine 31-jährige Reporterin des japanischen Sender NHK tot in ihrem Bett gefunden. Sie hatte 159 Überstunden in einem Monat angesammelt und vor ihrem Tod nur 2 Tage frei gehabt. Der Sender kündigte daraufhin an, die Arbeitskultur zu verbessern. Im April 2015 nahm sich die 24-jährige Matsuri Takahashi, eine Werbeagentur-Mitarbeiterin, das Leben. Zuvor hatte sie in Social Media geschrieben, sie sei „mental und körperlich am Ende.“
Jedes Jahr werden rund 150 Karoshi-Fälle von japanischen Behörden anerkannt. Das 1988 gegründete Karoshi-Netzwerk schätzt die Zahl derer, die arbeitsbedingt sterben, auf jährlich inzwischen gut 20.000 Menschen.
Was sind die Ursachen für Karoshi?
So tragisch Karoshi ist – so vielfältig sind die Ursachen und Gründe dafür. Genannt werden immer wieder die…
- Erziehung
Die japanische Gesellschaft ist eine Gemeinschaftskultur, in der man sich nicht selbst verwirklicht, sondern seinen Beitrag für die Gruppe leistet (Selbstaufopferung). Zudem ist die Kultur streng hierarchisch geprägt. Widerspruch kommt darin praktisch nicht vor. - Angst vor Gesichtsverlust
Den Eltern beichten zu müssen, dass man sein Pensum nicht schafft, kommt einer Schande gleich – für die gesamte Familie. Viele versuchen deshalb irgendwie durchzuhalten. - Angst vor Jobverlust
Eine der Hauptursachen für Karoshi liegt in den Beschäftigungsverhältnissen in Japan: Seit Jahren wachsen die unsicheren Arbeitsverhältnisse mit befristetem Arbeitsvertrag. Wer nicht fleißig klotzt, fliegt.
Karoshi in Deutschland
Sterben für die Arbeit? Dokumentierte Fälle von Karoshi gibt es in Deutschland zwar (noch) nicht. Begriffe wie „Leistungsgesellschaft“ und „Workaholic“ zeigen aber, dass sich manche für die Arbeit aufopfern und diese durchaus krank machen kann.
Die berufsbedingten psychischen Erkrankungen nehmen hierzulande seit Jahren zu. Und sie betreffen immer mehr junge Menschen, Frauen vor allem. Gleichzeitig steigt auch in Deutschland die Zahl der befristeten Arbeitsverträge und durch zunehmende Krisen die generelle Jobunsicherheit.
Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes arbeiten rund elf Prozent der Erwerbstätigen mehr als 48 Stunden pro Woche. So verwundert es nicht, dass auch die Fälle von Burnout oder Depressionen zunehmen.
Karoshi Symptome
Der Tod durch Überarbeitung kommt zwar meistens plötzlich. Aber Warnzeichen für einen drohenden Burnout oder Schlimmeres sendet der Körper schon früher. Auf folgende Symptome sollten Sie bei anhaltendem beruflichen Stress achten:
- Kopfschmerzen
Permanenter Stress senkt die Reizschwelle für die Nerven. Effekt: Es kommt zu Muskelverspannungen (z.B. Rückenschmerzen) und häufigen Kopfschmerzen. - Schlafprobleme
Forscher gehen heute davon aus, dass Stress die ACTH- und Cortisolwerte hochschnellen lässt. Das dämpft die Melatonin-Produktion in der Nacht. Die Folge sind Schlafstörungen und Einschlafprobleme. - Schwindelattacken
Wer über einen längeren Zeitraum schlecht schläft, ist am Tag müde und kaputt. Das sympathische Nervensystem ist zudem überlastet, und es kommt zur Erhöhung der Atemfrequenz und immer wieder zu starken Schwindelgefühlen. - Appetitlosigkeit
Manche reagieren auf Stress mit Heißhungerattacken und greifen vermehrt zu Schokolade und Süßigkeiten. Andere antworten auf die zahlreichen Stressfaktoren mit Appetitlosigkeit. Beide Extreme sind – wenn sie chronisch auftreten – starke Warnzeichen und Symptome für eine Überlastung. - Magen-Darm-Erkrankungen
Gleiches gilt für häufige Magen-Darm-Probleme, Verstopfung oder Durchfall. Auch hier spielt das Hormon ACTH eine Rolle: Es kann Schmerzen und Krämpfe verursachen. Durch eine vermehrte CRF-Ausschüttung wiederum wird die Dehnfähigkeit des Magens verringert, was Durchfälle und Reizdarmsymptome fördert.
Sollten Sie eines oder mehrere Symptome an sich beobachten, suchen Sie bitte umgehend Ihren Hausarzt oder einen Psychologen auf!
Wie dem Karoshi Syndrom vorbeugen?
Niemand sollte sich zu Tode schuften – weder in Japan noch in Deutschland oder anderswo. Umso wichtiger ist, etwaige Symptome und Warnzeichen einer ungesunden Arbeitskultur frühzeitig zu erkennen und entsprechend gegenzusteuern.
Gegen chronischen Stress helfen mehr und vor allem regelmäßige Pausen alle 90 Minuten sowie eine ausgeglichene Lebensbalance bzw. Work-Life-Balance.
Allerdings liegt die Verantwortung nicht nur bei den Arbeitgebern, ein entsprechend gesundes Arbeitsumfeld mit angemessenen und flexiblen Arbeitszeiten, einem ergonomischen Arbeitsplatz und wertschätzendem Umfeld zu schaffen. Dem Karoshi-Syndrom kann auch jede(r) Einzelne durch eine bessere und gesündere Lebensweise vorbeugen.
Ansonsten bleibt als ultima ratio immer der letzte Ausweg: Job kündigen – und sich eine neue Stelle suchen, in der Karoshi ausgeschlossen ist.
Was andere dazu gelesen haben