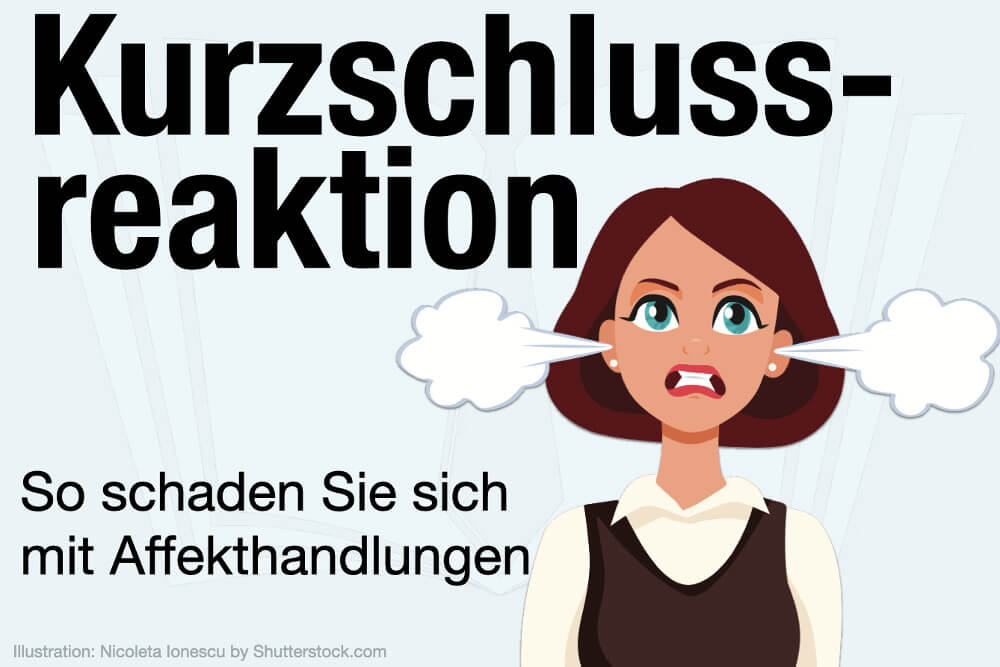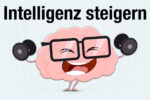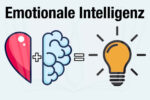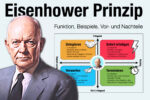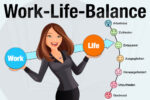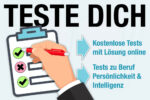Definition: Was ist eine Kurzschlussreaktion?
Eine Kurzschlussreaktion ist eine unüberlegte Handlung, die aus einem spontanen und emotionalen Impuls heraus erfolgt. Sie denken nicht nach, sondern entscheiden voreilig und merken erst später, welche Folgen Ihr Verhalten hat.
Der Begriff stammt aus der Elektrik. Fließt der Strom zwischen zwei Polen einer Spannungsquelle ohne Widerstand, kommt es zum Kurzschluss. Übertragen auf menschliches Verhalten fehlt ebenfalls ein Widerstand – in Form von Besonnenheit und Reflexion.
Auslöser für eine Kurzschlussreaktion
Hervorgerufen werden Kurzschlussreaktionen meist durch bereits länger schwelende Konflikte. Es ist der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt: Aus einem aktuellen Anlass heraus entlädt sich der Frust oder die Anspannung. Sie haben den Zustand lange ertragen und können die Emotionen nicht mehr kontrollieren.
Kurzschlussreaktionen können auch spontan entstehen. Sie fühlen sich plötzlich so ungerecht behandelt oder verletzt, dass Ihr Gehirn für einige Momente ausgeschaltet wird. Ihre Reaktion in Form von unbedachtem Verhalten oder Worten erfolgt, bevor Sie die Konsequenzen bedenken. Hintergrund sind starke Emotionen wie:
- Eifersucht
- Enttäuschung
- Gekränktheit
- Rachsucht
- Trauer
Kurzschlussreaktion Synonym
Synonym zur Kurzschlussreaktion sind die Begriffe: Affekthandlung, Kurzschlusshandlung, spontane Reaktion, Schnellschuss oder übereilte Aktion. Begleitet werden die reaktiven Handlungen durch starke, kurz andauernde Emotionen – sogenannte Affekte wie Wut oder Angst.
Kurzschlussreaktion: Psychologie
Die Psychologie erklärt eine Kurzschlussreaktion durch unterschiedliche Verarbeitungen von Emotionen im Gehirn. Verantwortlich ist für solch emotionale Prozesse grundsätzlich das limbische System. Allerdings können Reize und Gefühle hier unterschiedlich weitergeleitet werden:
- Über die Amygdala
Die Amygdala ist für schnelle Reaktionen wie den Fluchtreflex zuständig. Bei Gefahren wird sofort gehandelt, weil schlicht keine Zeit für längere kognitive Prozesse bleibt. Für unsere Vorfahren war das überlebenswichtig. - Über den Neocortex
Über den Neocortex und andere Bereiche des Gehirns werden Emotionen langsamer und rationaler verarbeitet. Situationen werden analysiert, Optionen abgewogen und mögliche Konsequenzen berücksichtigt. Hier denken wir tatsächlich nach.
Bei starken emotionalen Signalen, wird die Abkürzung über die Amygdala genommen. Bei einer Kurzschlussreaktion hat das Gehirn gar keine Chance nachzudenken. Sie handeln bereits aus dem ersten Impuls („aus dem Affekt„) heraus – der eigentliche Denkapparat wird übersprungen.
Kurzschlussreaktionen bei psychischen Störungen
Häufiger kommt es bei Menschen mit psychischen Störungen zu Kurzschlussreaktionen. Sie haben einen Mangel an Impulskontrolle. Betroffen sind beispielsweise Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Sie leiden unter emotionaler Instabilität, sind impulsiv und neigen zu riskantem oder aggressivem Verhalten. Affekthandlungen müssen aber nicht für Persönlichkeitsstörungen sprechen. Reizbarkeit, Unsicherheit oder Stimmungsschwankungen können ebenso Auslöser sein. Auch Schlafmangel, Drogen- oder Alkoholkonsum enthemmen und sorgen für heftigere Reaktionen.
Folgen der Kurzschlussreaktion
Juristisch und kriminologisch kann eine Kurzschlussreaktion vom Psychiater oder Psychologen entsprechend eingestuft werden und bei Bewusstseinsstörungen zu Schuldunfähigkeit führen. Im Berufs- oder Privatleben müssen Sie sich den Folgen solch spontaner Handlungen stellen. Chef, Kollegen, Partner oder Freunde wissen genau, was Sie getan oder gesagt haben – und ziehen Sie zur Verantwortung.
Wer dem Chef im Affekt eine schriftliche Kündigung auf den Tisch knallt, beendet tatsächlich das Arbeitsverhältnis. Ebenso können Sie eine fristlose Kündigung erhalten, wenn Sie wütend Beleidigungen schreien oder jemanden körperlich angreifen.
Kurzschlussreaktion Trennung
Bei privaten Beziehungen kann eine Kurzschlussreaktion massive Kränkungen zur Folge haben. Anschuldigungen im Sinne von „Was ich dir schon immer sagen wollte…“ mögen unbedacht sein, sind aber so verletzend, dass Freundschaften und Partnerschaften daran zerbrechen können. Eine Trennung ist dann kaum noch zu verhindern. Erklärungsversuche wie „Ich war wütend und habe es nicht so gemeint“ bringen wenig.
Kurzschlussreaktion verhindern: Kontrollieren Sie Ihre Gefühle
Sie neigen zu Kurzschlussreaktionen und haben schon häufiger vorschnell gehandelt, wenn Sie unter Stress oder emotionaler Belastung stehen? Dann können Sie lernen, Ihre Gefühle besser zu kontrollieren und so Affekthandlungen zu verhindern. In der Praxis haben sich drei Methoden etabliert:
-
Ausgleich
Stauen sich Frust und andere negative Emotionen auf, brauchen Sie einen Ausgleich. Die optimale Gestaltung hängt von Ihrer Persönlichkeit und den individuellen Vorlieben ab. Beim Sport können Sie Dampf ablassen, Adrenalin abbauen und Glückshormone ausschütten. Im Gespräch mit Freunden können Sie zur Ruhe kommen und Tipps erhalten. Andere finden innere Ruhe mit Meditation oder Entspannungsübungen.
-
Ablenkung
Lenken Sie sich ab und ziehen Sie sich aus der Situation zurück, bevor Sie reagieren können. Ideal ist eine Ablenkung, die andere Sinne involviert. Zuhause kann es eine kalte Dusche sein. Im Job können Sie die Pause zu einem Spaziergang an der frischen Luft nutzen. Hier können Sie durchatmen und bekommen neue Sinneseindrücke. Auch Musik, mit der Sie positive Emotionen verbinden, ist eine gute Ablenkung und baut Stress spürbar ab.
-
Einstellung
Langfristig hilft eine Verbesserung Ihrer generellen Einstellung. Lebensfreude und Optimismus geben Ihnen auf Dauer ein Gefühl der Gewissheit, dass Sie Konfliktsituationen und Probleme lösen können – ohne emotionale Ausbrüche. Gestehen Sie sich und anderen Menschen Fehler zu. Dann können Sie entspannter darauf reagieren.
Kurzschlussreaktion rückgängig machen
Manchmal lässt sich die Kurzschlussreaktion nicht verhindern. Wenn es doch einmal passiert, sollten Sie im Nachhinein das Beste daraus machen. Diese Tipps helfen, um die Situation nach einer Affekthandlung wieder geradezubiegen:
-
Selbstreflexion
Zur Kurzschlussreaktion gehört, dass Sie schneller reagiert haben, als Sie nachdenken konnten. Das holen Sie durch Selbstreflexion nach: Was ist da gerade passiert, wieso habe ich so reagiert, was hat das Verhalten des Gesprächspartners in mir ausgelöst? Habe ich womöglich überreagiert? Basiert meine Reaktion auf einem Missverständnis?
-
Reue
Vielleicht haben Sie in der Sache sogar recht gehabt: Der Punkt ist, wie Sie es kommunizieren. Zeigen Sie Reue und entschuldigen Sie sich für Ihr Verhalten. Das heißt nicht, dass Sie inhaltlich im Unrecht waren – Sie geben aber zu, dass Ihr Verhalten unpassend war. Dabei ist es egal, ob Sie laut geworden sind oder anderweitig unangemessen reagiert haben.
-
Friedensangebot
Nach der Kurzschlussreaktion sollten Sie auf Ihr Gegenüber zugehen und ein Friedensangebot machen. Wie lässt sich das Problem lösen? Zeigen Sie guten Willen und die Fähigkeit, konstruktiv mit der Lage umzugehen. Manch eine impulsive Handlung ist verzeihlich und Sie bieten eine mögliche Lösung an.
Was andere dazu gelesen haben