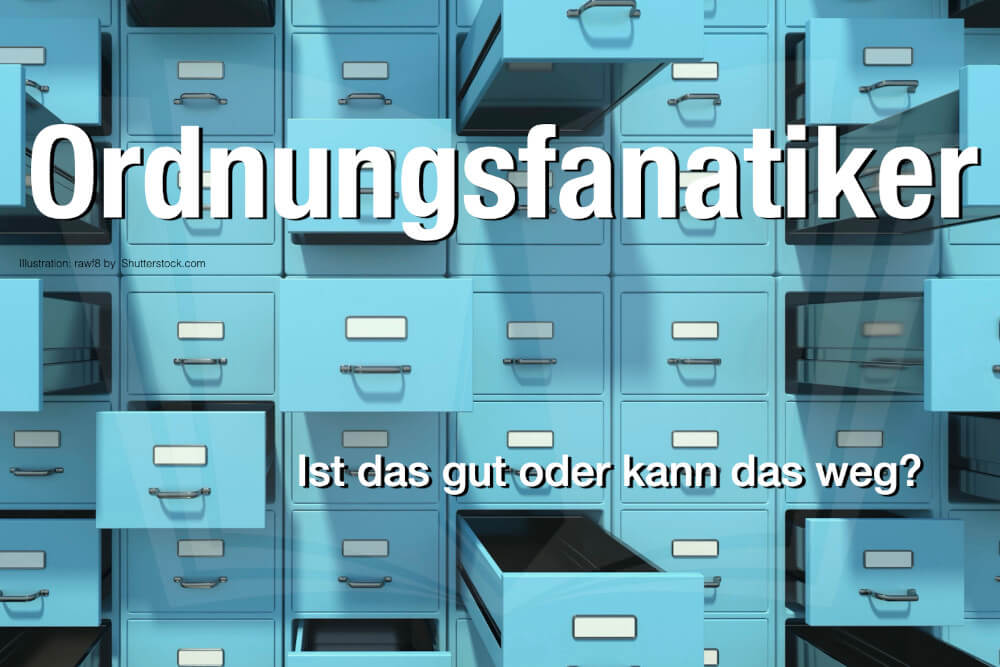Bedeutung: Was ist ein Ordnungsfanatiker?
Als Ordnungsfanatiker werden Menschen bezeichnet, die ein übersteigertes Bedürfnis nach Ordnung und Struktur haben und immer wieder zwanghaft versucht, Gegenstände oder Kleidung aufzuräumen und zu sortieren. Das geht über einen ordentlichen Menschen hinaus: Der Ordnungsfanatiker hält sich sklavisch an sein System oder seine Struktur. Akten, Bücher, Stifte werden säuberlich nach Farben bzw. Alphabet sortiert und geometrisch ausgerichtet.
Ein schiefes Bild an der Wand können sie schlecht ertragen. Und bringt jemand die arrangierte Ordnung durcheinander, erleben Betroffene ein starkes Störgefühl und Unbehagen, dass sogar die Lebensqualität beeinträchtigen kann.
Ordnungsliebe oder Zwangsstörung?
Im Gegensatz zur Ordnungsliebe handelt es sich beim Ordnungswahn (auch: Ordnungszwang) um eine Zwangsstörung, die als Krankheit im ICD-10 klassifiziert ist. Dabei wird zwischen zwei Formen von Zwangsstörungen unterschieden:
-
Zwangsgedanken
Dazu gehören Zählzwang, Grübelzwang, zwanghaft aggressive Gedanken, ständige Ängste oder Zweifel.
-
Zwangshandlungen
Hierunter zählen Zwänge wie Berührzwang, Kontrollzwang, Waschzwang oder der Ordnungszwang bzw. Ordnungsfanatiker.
Leiden Ordnungsfanatiker an einer Krankheit?
Ordnungsfanatiker wirken sie auf Außenstehende schnell pedantisch oder wie Exzentriker, die ihre Marotten pflegen. Doch der Grat zwischen ausgeprägtem Ordnungssinn, einem lustigen Spleen und echter Zwangsstörung ist schmal und nicht immer eindeutig zu diagnostizieren.
Nicht jeder, der eine Aversion gegen Unordnung hat oder gerne aufräumt und alles ordentlich sortiert, ist psychisch krank. Daher gilt bei psychologischen Etikettierungen: Nicht vorschnell urteilen! Der Zusatz „Fanatiker“ kann auch einfach eine umgangssprachliche Zuspitzung sein.
Sind Zwänge immer schlecht?
Leiden Menschen unter zwanghaftem Verhalten und schränkt sie das in ihrer Freiheit ein, ist das natürlich schlecht und ungesund. Verhaltensmuster können aber ebenso aus erlernten Routinen bestehen, die sich für Betroffene als nützlich erwiesen haben. Nur weil jemand ein anderes Umfeld benötigt als wir selbst, muss das nichts Falsches oder spießig sein.
Problematisch wird es jedoch dann, wenn sich die Ordnungsliebe und Routine vom eigentlichen Sinn und Zweck entfernt – der Ordnungsfanatiker also nur noch um des Aufräumens selbst aufräumt. Aus dem Hilfsmittel wird dann ein Selbstzweck, der Arbeitsabläufe nicht erleichtert, sondern erschwert.
Was sind die Ursachen für Ordnungsfanatismus?
Für einen Ordnungszwang kann es verschiedene Ursachen geben. Manchmal sind die Menschen auch nur ordentlich, weil sie es müssen – weil zum Beispiel im Unternehmen eine Clean Desk Policy existiert (siehe auch: 5s-Methode). Auch verhalten sich manche auf der Arbeit anders als zuhause.
Generell folgen Ordnungsfanatiker meist einem speziellen Bedürfnis oder beabsichtigen mit ihrer Ordnung eine bestimmte Funktion. Beispiele:
-
Sicherheit
Alles ist an Ort und Stelle – das gibt Ordnungsfanatikern das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Ihr Leben verläuft in geordneten Strukturen – und sie selbst haben diese im Griff.
-
Bequemlichkeit
Ordnungsliebhaber suchen ungerne. Entsprechend entwickeln sie Systeme und Strukturen, die ihnen die Arbeit und den Alltag erleichtern. Eine Form der intelligenten Faulheit.
-
Aktionismus
Ebenso kann hinter Ordnungsfanatismus Aktionismus stecken – ein Art Ablenkung und Prokrastination, um sich vor der eigentlichen Aufgabe zu drücken.
-
Überforderung
Zum Teil verrät Ordnungszwang jemanden, der Probleme damit hat, Prioritäten zu setzen. Die Ordnung hilft, den fehlenden Überblick zu schaffen und sich besser zu organisieren.
Chaos vs. Ordnung: Was ist besser?
Die Frage, ob Ordnung oder Unordnung besser ist, spaltet die Menschen regelmäßig in zwei Lager. Klar, jede(r) möchte lesen, dass seine Vorliebe richtig ist und mehr Vorteile hat. Die einen sagen: „Ordnung ist das halbe Leben – ich lebe in der anderen Hälfte.“ Die anderen sind überzeugt: „Nur das Genie beherrscht das Chaos!“ Beide haben Recht.
Die Vorteile von Chaos
Studien von Kathleen Vohs von der Universität von Minnesota zeigen zum Beispiel, dass Chaos auf dem Schreibtisch die Kreativität fördert. Sind Büros und Schreibtische zu steril und unpersönlich, hemmt das manchen Geistesblitz (siehe auch: Schreibtisch Typen).
Die Psychologin Isabella Efthimiou spricht sich ebenfalls gegen extreme Ordnung aus. Sie glaubt, es schade dem inneren Frieden – zu organisierte Menschen seien unruhiger und anfälliger für einen Burnout.
Die Vorteile von Ordnung
Auch mehr Ordnung hat zahlreiche Vorteile, die Ordnungsfanatiker gerne ins Feld führen: Moderne Arbeitsmodelle wie Desk Sharing, bei dem Arbeitnehmer den Schreibtisch nutzen, der gerade frei ist, würden ohne Ordnung nicht funktionieren. Auch sparen feste Strukturen Suchzeit, reduzieren Fehler und sorgen so für höhere Produktivität.
Eine Studie des Stuttgarter Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung hat ergeben, dass fehlende Arbeitsutensilien sowie die Suche nach Dokumenten rund zehn Prozent der Arbeitszeit kostet. Hinzu kommt, dass sich Chaos häufig selbst verstärkt (siehe: Broken-Window-Effekt): Ist die Unordnung einmal da, wächst sie schnell weiter und findet obendrein Nachahmer.
Messies wissen das nur zu gut.
Tipps: Was ist eine gesunde Ordnung?
Die Grauzone zwischen ausgeprägtem Ordnungssinn und harmonischer Ordnungsliebe auf der einen Seite sowie Ordnungszwang und einem veritablen Ordnungsfanatiker auf der anderen, ist zum Glück breit. Finden Sie für Ihr psychisches Wohlbefinden den optimalen Mittelweg.
Wenn Sie im Job Ihren Arbeitsplatz ordentlich halten wollen, empfehlen wir folgende Schritte:
-
Häufigkeit
Dinge, die Sie häufig brauchen, sollten Sie griffbereit haben. Die gehören entweder auf den Schreibtisch oder in die oberste Schublade.
-
Zuordnung
Finden Sie einen festen Platz für die Dinge, die Sie nur gelegentlich brauchen. Sortieren Sie ähnliche Gegenstände oder Unterlagen in denselben Bereich. Das erleichtert die Wiederauffindbarkeit.
-
Entsorgung
Das größte Problem bei Messies ist, dass sie nichts wegschmeißen können. Trennen Sie sich stattdessen konsequent von Dingen, die Sie nicht mehr brauchen oder in einem Jahr nicht gebraucht haben.
-
Routine
Machen Sie es sich zur Routine, jeweils wenige Minuten vor Feierabend Ihren Schreibtisch aufzuräumen. Das wirkt professionell auf andere und deutlich motivierender am nächsten Morgen.
Was andere dazu gelesen haben
- KonMari-Methode: So ordnen Sie Ihr Leben neu
- Büroeinrichtung: So macht sie produktiver