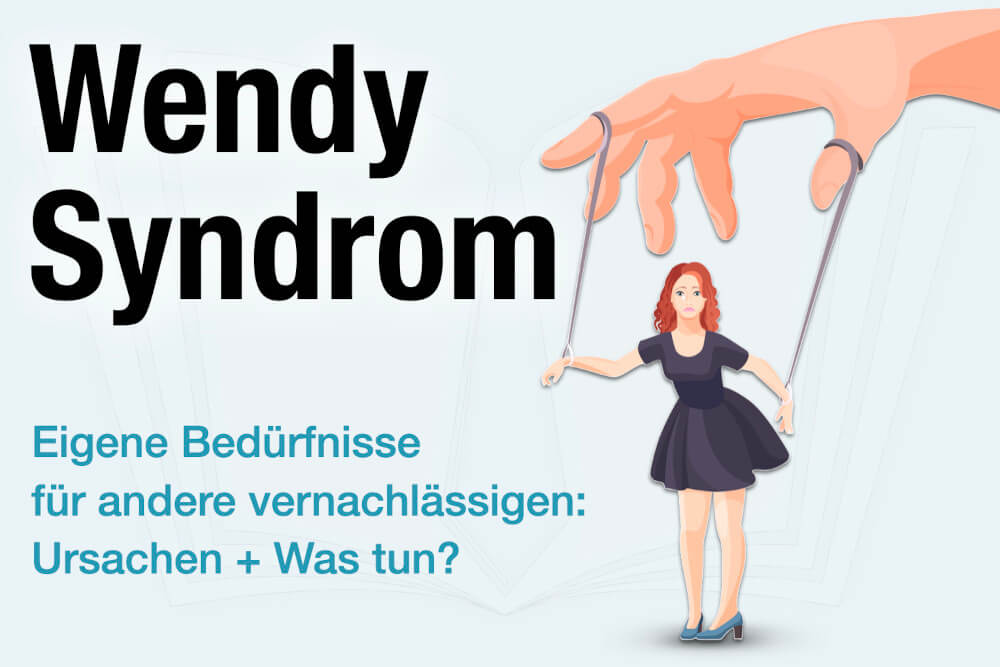Definition: Was ist das Wendy-Syndrom?
Das Wendy-Syndrom bezeichnet ein psychologisches Verhaltensmuster, bei dem insbesondere Frauen ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zurückstellen und stattdessen übermäßig für andere – meist den Partner oder die Familie – sorgen. Betroffene glauben oft, ihren Selbstwert über ihre Fürsorge und Aufopferung für andere zu definieren.
Charakteristisch ist, dass Betroffene die Verantwortung für alles so stark übernehmen, dass sie sich in den Beziehungen selbst „verlieren“. Häufig übernehmen sie dabei – ähnlich wie die Figur „Wendy Darling“ aus dem Märchen „Peter Pan“ – eine Über-Mutterrolle: Sie kümmern sich um alles, organisieren, trösten, halten den Laden am Laufen – und vergessen sich dabei selbst.
Typische Merkmale des Wendy-Syndroms
- Ständiges Gefühl, für das Wohlbefinden anderer verantwortlich zu sein
- Übernahme von Aufgaben anderer – trotz bestehender Überlastung
- Schwierigkeiten, Nein zu sagen
- Vernachlässigung eigener Bedürfnisse
- Ausgeprägtes Harmoniebedürfnis und Angst vor Ablehnung
Das Wendy-Syndrom ist jedoch keine offizielle Krankheit, sondern ein populärpsychologischer Begriff für ein ungesundes Beziehungsmuster, das auf Dauer zu emotionaler Erschöpfung führen kann.
Was sind Wendy-Syndrom Symptome?
Das typische Verhalten von „Wendys“ zeichnet sich vor allem durch große Aufopferung und Hingabe aus. Weitere Wendy-Syndrom Symptome sind:
-
Permanentes Verantwortungsgefühl
Betroffene haben das ständige Gefühl, für die Gefühle und das Wohlergehen anderer verantwortlich zu sein. Geht es jemandem schlecht, suchen sie die Schuld bei sich und möchten alles tun, damit es der Person wieder besser geht.
-
Unfähigkeit, Nein zu sagen
Aus Angst, andere zu enttäuschen oder die Harmonie zu gefährden, sagen Betroffene nie „Nein“. Es fällt ihnen enorm schwer, Grenzen zu setzen oder eigene Bedürfnisse anzumelden.
-
Suche nach Anerkennung
Der eigene Wert wird stark über die Fürsorge und Aufopferung für andere definiert. Dabei suchen die „Wendys“ jedoch ebenfalls ständig nach Lob und Dankbarkeit, um sich besser zu fühlen.
-
Kontrollbedürfnis & Perfektionismus
Nicht wenige möchten durch ihre Hingabe gleichzeitig alles unter Kontrolle haben: Kümmern sie sich um alle organisatorischen Dinge, verlassen sie sich ungern auf andere. Aufgaben werden übernommen, bevor jemand darum bittet.
-
Angst vor dem Alleinsein
Betroffene Menschen fühlen sich meist unwohl, wenn sie auf sich selbst gestellt sind. Persönliches Glück definieren sie über ihr „Gebraucht-Werden“. Gleichzeitig weichen sie Konflikten aus – eben, um diese Abhängigkeits-Beziehungen nicht zu gefährden.
An den Symptomen merkt man bereits, dass das Wendy-Syndrom ein belastendes und ungesundes Beziehungsmuster darstellt. Auf Dauer führt es zu enormer Überforderung durch chronischen Stress sowie zu emotionaler Erschöpfung (siehe: Mental Load), Frustration und innerer Leere. Auch eine Depression kann Folge des Syndroms sein.
Gegenstück: Was ist das Peter-Pan-Syndrom?
Während das Wendy-Syndrom Menschen beschreibt, die sich aufopferungsvoll um andere kümmern, stellt das Peter-Pan-Syndrom das passende Gegenstück dazu dar: Menschen, die sich bemuttern lassen und die permanente Hilfe in Anspruch nehmen.
Laut Definition beschreibt das Peter-Pan-Syndrom ein Verhalten bei Erwachsenen, die sich weigern, erwachsen zu werden, Verantwortung zu übernehmen oder selbstständig handeln. Auch dieser Begriff basiert auf der literarischen Figur „Peter Pan“, der ewig ein Kind bleiben will.
Obwohl beide Syndrome bei beiden Geschlechtern vorkommen, sind statistisch vom Wendy-Syndrom meist Frauen, vom Peter-Pan-Syndrom hingegen überwiegend Männer betroffen.
Peter-Pan-Syndrom – Symptome
Zu den typischen Merkmalen des Peter-Pan-Syndroms gehören:
-
Unreifes Verhalten
Ein generelles Verhalten, das nicht dem Alter entspricht – zum Beispiel kindisch, impulsiv, trotzig, wenig Selbstdisziplin und geringe Frustrationstoleranz.
-
Vermeiden von Verantwortung
Ob im Beruf oder in der Familie: Betroffene vermeiden Verantwortung und lehnen z.B. finanzielle Aufgaben ab oder ignorieren diese schlimmstenfalls.
-
Genrelle Entscheidungsschwäche
Betroffene haben grundsätzlich Schwierigkeiten damit, Entscheidungen zu treffen und konkrete Pläne für die Zukunft zu machen.
-
Mangel an Verbindlichkeit
Die Verantwortungslosigkeit zeigt sich meist auch in Beziehungen: „Peter Pans“ haben Angst vor festen Bindungen, häufige Partnerwechsel oder die Erwartung, dass der Partner die „Elternrolle“ übernimmt.
-
Soziale Schwierigkeiten
Zu den typischen Symptomen gehören ebenfalls oberflächliche Freundschaften sowie instabile Beziehungen. Oft ziehen sich Betroffene in eine Fantasiewelt oder Tagträume zurück und haben völlig unrealistische Lebensziele.
-
Latenter Narzissmus
Das Peter-Pan-Syndrom kann sich sogar an narzisstischen Zügen, wie Selbstverliebtheit oder dem Wunsch im Mittelpunkt zu stehen, zeigen.
Auch das Peter-Pan-Syndrom ist keine anerkannte psychische Erkrankung oder Diagnose. Dennoch gelten beide Syndrome – Wendy und Peter-Pan – als „Partnersyndrom“, weil sie sich gegenseitig ergänzen. Obwohl sie beide ungesund und belastend sind, suchen sich die Betroffenen gegenseitig und kommen so dennoch zu zwar schädlichen, aber einigermaßen stabilen Beziehungen.
Was sind die Wendy-Syndrom Ursachen?
Die Ursachen für das Wendy-Syndrom sind vielschichtig und beruhen häufig auf persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Faktoren. Dazu gehören:
-
Kindheitserfahrungen
Betroffene Frauen wurden oftmals schon in der Kindheit in eine „Mutterrolle“ gedrängt – zum Beispiel weil Eltern überfordert, emotional abwesend oder kritisch und kontrollierend waren. Oft mussten sie früh Verantwortung für Geschwister übernehmen und haben dabei gelernt, Anerkennung und Sicherheit nur durch Fürsorge für andere zu bekommen.
-
Geringes Selbstwertgefühl
Ein generell niedriges Selbstwertgefühl und persönliche Unsicherheit begünstigen das Wendy-Verhalten. Das „Gebrauchtwerden“ wertet die Menschen auf, sie fühlen sich dadurch nützlicher und wertvoller.
-
Ausgeprägtes Harmoniebedürfnis
Betroffene wollen möglichst keine Fehler und es allen recht machen. Sie vermeiden Streit, wo es nur geht und stellen die eigenen Vorstellungen, Bedürfnisse und Wünsche dafür zur Not auch hinten an. Das reicht bis zur Selbstausbeutung.
-
Angst vor Ablehnung
Eine der größten Sorgen ist die große Angst davor, nicht mehr geliebt oder zurückgewiesen zu werden, wenn sie Bitten ablehnen. Betroffene haben deshalb große Probleme mit Abgrenzung und sind konfliktscheu.
-
Kulturelle Prägungen
Nicht zu unterschätzen ist beim Wendy-Syndrom die Rolle, die Frauen oft gesellschaftlich zugeschrieben wird: Sie sollen vor allem fürsorglich, hilfsbereit und bescheiden sein. Diese Erwartungshaltung führt zu Rollenkonflikten und wird oft noch durch die Familie oder den Partner verstärkt.
In den meisten Fällen ist es eine Kombination aus familiärer Prägung, mangelndem Selbstwert und gesellschaftlichen Rollenbildern, die das Wendy-Syndrom entstehen lassen.
Wendy-Syndrom Test: Bin ich betroffen?
Falls Sie sich gerade fragen, ob Sie vom Wendy-Syndrom betroffen sind, können Sie den folgenden kurzen Test absolvieren. Der ist kein Ersatz für eine medizinische Diagnose, sondern soll Ihnen nur erste Hinweise geben, ob Sie am Wendy-Syndrom leiden könnten.
Zutreffende Aussagen können Sie gleich online im Browser abhaken und zusammenzählen:
- Ich habe Schwierigkeiten, meine eigenen Wünsche zu formulieren.
- Die Probleme anderer mache ich häufig zu meinen eigenen.
- Ich denke für andere ständig mit.
- Mein Partner drückt sich ständig vor der Hausarbeit.
- Entscheidungen zu Urlaub, Essen oder Finanzen bleiben immer an mir hängen.
- Konflikten gehe ich möglichst aus dem Weg.
- Ich habe Probleme damit, Dinge loszulassen.
- Ich bin sehr selbstkritisch.
- Ich arbeite auch nach Feierabend noch im Haushalt, während mein Partner abschaltet.
- Auf der Arbeit mache ich häufig Überstunden, um noch Kollegen zu helfen.
- Ich habe sofort ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal „Nein“ sage.
- Wenn ich andere mal um Hilfe bitte, hat niemand Zeit.
- Alleine fühle ich mich immer unwohl.
Auflösung zum Test
Wenn Sie nur maximal drei Aussagen zustimmen konnten, ist alles noch im grünen Bereich. Sie leiden vermutlich nicht am Wendy-Syndrom, werden aber teilweise ausgenutzt oder die Aufgabenverteilung zuhause oder im Job ist nicht ausgewogen. Haben Sie hingegen schon mehr als drei Aussagen abgehakt, sollten Sie das genauer untersuchen (lassen).
Was sind mögliche Folgen des Wendy-Syndroms?
Wie eingangs erwähnt, ist das Wendy-Syndrom ein langfristig schädliches Verhaltensmuster – sowohl für die Psyche als auch für die körperliche Gesundheit. Die möglichen Folgen sind weitreichend und können die Beziehungen sowie Job und Karriere massiv und negativ beeinflussen.
Zu den häufigsten Folgen zählen:
-
Völlige Erschöpfung (Burnout)
Dauerhafte Selbstaufopferung führt nicht nur zu wachsender Überforderung – früher oder später endet das für Betroffene in einem Burnout bzw. Burn-On. Im Extrem kann das Ausbrennen in eine Depressionen münden.
-
Fehlende Entwicklung
Die Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse sorgt dafür, dass Betroffene den Bezug zu sich selbst verlieren. Fehlende Selbstfürsorge aber belastet die eigene Entwicklung und Lebensgestaltung.
-
Angestaute Wut
Hinzu kommt: Wenn eigene Wünsche und Grenzen permanent ignoriert werden, entsteht große Frustration. Und was lange gärt, wird schließlich Wut, verdeckte oder offene Aggression oder Traurigkeit.
-
Sinkender Selbstwert
Auch wenn es paradox klingt: Die Selbstaufopferung soll das Selbstwertgefühl steigern – tatsächlich passiert aber das Gegenteil. Denn das Gefühl und die Gewissheit, nur geliebt zu werden, wenn man sich für andere aufopfert, schwächt das Selbstwertgefühl dauerhaft.
-
Soziale Isolation
Wird die eigene Rolle auf Fürsorge für andere reduziert, geraten andere Lebensbereiche ins Hintertreffen. Das betrifft meist Freundschaften und persönliche Interessen. Effekt: Die Betroffenen werden de facto immer einsamer.
-
Gesundheitliche Beschwerden
Auf Dauer hat das auch körperliche Folgen: Der chronische Stress fördert Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Verspannungen, Diabetes sowie Herzerkrankungen oder Bluthochdruck.
Langfristig hat das Wendy-Syndrom gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebensqualität. Viele Beziehungen zerbrechen früher oder später daran – die zum Partner genauso wie zu Freunden oder Kollegen.
Wendy-Syndrom Behandlung: Was kann ich dagegen tun?
Auch wenn es der Name „Syndrom“ suggeriert: Die ärztliche Diagnose „Wendy-Syndrom“ gibt es offiziell nicht. Weil es ist keine anerkannte Krankheit gibt, gibt es auch keine offizielle Behandlung oder Therapie dagegen.
Dennoch können Sie selbst etwas tun, um dem Wendy-Syndrom entgegen zu wirken. Unsere Empfehlungen:
-
Reflektieren Sie die Situation
Wer bei sich Anzeichen des Wendy-Syndroms beobachtet oder glaubt, anfällig dafür zu sein, sollte innehalten: Sicher gibt es Phasen, in denen nahestehende Personen mehr Aufmerksamkeit als sonst benötigen, beispielsweise im Krankheitsfall oder bei kleinen Kindern. Vergessen Sie dabei aber auch sich selbst und Ihre Bedürfnisse nicht! Die sind nicht weniger wichtig.
-
Sorgen Sie für Ausgleich
Wird das Kümmern und Bemuttern zum Dauerzustand und zieht sich der Partner aus der Verantwortung heraus, sollten Sie hellhörig werden. Jeder Mensch braucht einen Ausgleich, nicht nur um seine persönliche Entwicklung zu ermöglichen, sondern auch um neue Kraft für anstehende Aufgaben zu tanken. Das können Hobbys und Sport sein, aber auch Fortbildungen, die Sie beruflich weiterbringen.
-
Beobachten Sie Ihr Umfeld
Das gilt für Partner wie Kollegen: Wer sich ständig für andere auspowert, bleibt irgendwann ausgebrannt und traurig zurück. Dann bereuen Sie, nicht auf Ihre eigenen Bedürfnisse geachtet und Chancen ergriffen zu haben. In einer gleichberechtigten Beziehung wird Ihrem Partner ebenfalls daran gelegen sein, Sie zu unterstützen. Im Job ist das nur kollegial.
-
Ergreifen Sie Maßnahmen
Das größte Problem beim Wendy-Syndrom ist nach Meinung von Humbelina Robles, Professorin für Psychologie an der Universität von Granada: Die Betroffenen erkennen nur selten, dass sie und ihr Partner Teil desselben Problems sind. Voraussetzung dafür, eine psychisch schädliche Verhaltensweise zu ändern, ist aber, diese erst einmal bewusst zu erkennen. Hier kann ein eine Verhaltenstherapie helfen. Die Therapie sollte sich jedoch nicht nur auf den Klienten konzentrieren, sondern gleichermaßen den (Peter Pan)-Partner beziehungsweise die Familie einbeziehen, um erfolgreich zu sein.
Was andere dazu gelesen haben