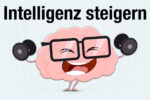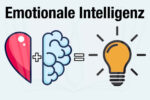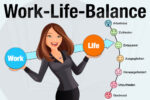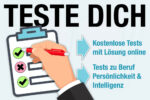Definition: Was ist Fachkräftemangel?
Fachkräftemangel ist ein Zustand auf dem Arbeitsmarkt, bei dem gut ausgebildete Arbeitnehmer für verschiedene Berufe und Branchen fehlen. Es gibt mehr freie Arbeitsstellen und Personalbedarf als Fachkräfte mit passender Qualifikation (Ausbildung oder Studium).
Wichtige Merkmale für den Mangel an qualifizierten Arbeitnehmern sind:
-
Vakanzzeit
Die Vakanzzeit misst die Dauer von der Ausschreibung einer offenen Stelle bis zur Besetzung mit einem geeigneten Mitarbeiter. Eine große Vakanz spricht für Fachkräftemangel.
-
Unbesetzte Stellen
Unternehmen melden regelmäßig, dass Stellen nicht besetzt werden können. Positionen bleiben frei, weil kein passender Arbeitnehmer gefunden wird.
-
Bewerbermangel
Auf freie Stellen gibt es keine oder nur wenige Bewerbungen. Arbeitgeber warten lange auf passende Kandidaten und haben wenige Auswahlmöglichkeiten.
-
Gehaltssteigerungen
Arbeitgeber bieten höhere Gehälter, um begehrte Fachkräfte zu gewinnen. Das Gehaltsniveau steigt teilweise deutlich und in kurzer Zeit.
-
Auszubildendenmangel
Bei Fachkräftemangel fehlt der Nachwuchs. Es gibt nicht genügend Azubis und Ausbildungsplätze werden nicht besetzt.
-
Überqualifikation oder Fehlqualifikation
Mancher Bewerber hat zwar einen akademischen Abschluss, aber nicht die für den konkreten Job erforderliche Praxiserfahrung oder branchenspezifische Qualifikation.
Gibt es Fachkräftemangel in Deutschland?
In Deutschland gibt es seit vielen Jahren einen Fachkräftemangel. Rund 530.000 Fachkräfte-Stellen konnten 2024 nicht besetzt werden – etwa die Hälfte davon betreffen „Mangelberufe“, bei denen es deutlich weniger Bewerber gibt als ausgeschriebene Positionen.
Laut dem KfW‑ifo Fachkräftemonitor gaben 44 Prozent der Unternehmen an, dass ihnen fehlende Fachkräfte das Geschäft erschweren. Besonders betroffen: der Dienstleistungssektor mit 48 Prozent, das verarbeitende Gewerbe mit 40 Prozent, Bau-Unternehmen mit 36 Prozent und Handel mit 34 Prozent.
Welche Branchen sind betroffen?
Viele Branchen spüren den Fachkräftemangel, einige Berufe sind aber besonders stark betroffen. Unsere Übersicht zeigt die Bereiche und Jobs mit dem größten Fachkräftemangel in Deutschland:
- Pflege- und Gesundheitsberufe, z.B. Altenpfleger, Fachkräfte in der Intensivpflege
- Handwerksberufe, einschließlich Elektroinstallateure, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker sowie Mechatroniker
- Berufe in Bau & Gebäudetechnik, z.B. Dachdecker, Bauingenieure
- IT und Technologie, etwa Softwareentwickler, IT-Sicherheitsexperten, Cloud-Engineers. Über 100.000 IT-Fachkräfte fehlen derzeit bundesweit
- Lehrer und Erzieher, insbesondere in MINT-Fächern und Grundschulen
- Berufskraftfahrer und Logistikpersonal – stark nachgefragt, etwa aufgrund des Online-Handel-Booms
- Verkauf und Einzelhandel, insbesondere Verkäufer.
- Sozialarbeit & Kinderbetreuung, einschließlich Sozialarbeiter, Erzieher. Hier gibt es noch eine große Lücke, trotz prognostiziertem Zuwachs
- IT und Digitalisierungstechnologie, stark wachsender Bedarf, aber nicht ausreichend Fachkräfte verfügbar
Ist der Fachkräftemangel Lüge oder Realität?
Oft wird der Fachkräftemangel kleingeredet oder als Lüge abgetan. Häufiges Argument: Es gibt viele Arbeitslose (aktuell rund 2,9 Millionen) – also sind grundsätzlich genug Fachkräfte vorhanden! Ein Trugschluss, weil Menschen ohne Beschäftigung nicht automatisch die benötigten Fähigkeiten besitzen.
Fachkräftemangel bezieht sich auf das Fehlen von Ausbildung, Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen. Auch bei hoher Arbeitslosigkeit und vielen Jobsuchenden bleiben Stellen unbesetzt, weil Berufsausbildung und Know-how fehlen.
Die Bundesregierung rechnet damit, dass bis 2035 etwa 7 Millionen Fachkräfte fehlen könnten, sofern dem nicht massiv durch Zuwanderung, Qualifizierung und höhere Erwerbsquoten entgegengewirkt wird.
Ursachen für den Fachkräftemangel
Es gibt nicht nur einen einzelnen Grund für den Fachkräftemangel in Deutschland. Die Ursachen sind ein Zusammenspiel zahlreicher Faktoren:
-
Demografischer Wandel
Die Bevölkerung wird immer älter. Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Rente, es kommen deutlich weniger junge Arbeitnehmer nach. So steigt der Fachkräftemangel jedes Jahr weiter an.
-
Technologischer Wandel
Schnelle technologische Entwicklungen verändern die Arbeitswelt. Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz verlangen nach Weiterbildungen und neuen Qualifikationen. Die Nachfrage ist groß, gefragte Fähigkeiten aber (noch) nicht vorhanden.
-
Bildungslücke & mangelnde Weiterbildung
Viele Beschäftigte verfügen nicht über die Qualifikationen, die in Zukunft gefragt sind. Gleichzeitig werden zu wenige Weiterbildungen genutzt oder angeboten. Auch die Berufsorientierung in Schulen ist oft unzureichend, sodass Schüler Berufe mit Zukunftspotenzial nicht kennen oder meiden.
-
Ungleichgewicht von Studium und Ausbildung
Die Zahl der Studenten steigt, gleichzeitig machen immer weniger junge Menschen eine Ausbildung. Das verzögert den Berufseinstieg und verstärkt den Fachkräftemangel in zahlreichen Ausbildungsberufen.
-
Attraktivität von Berufen
Schlechte Arbeitsbedingungen, geringes Gehalt und schlechte Zukunftsperspektiven – manche Berufe gelten als unattraktiv. Es fehlen Anreize, um junge Menschen für die Berufswahl zu begeistern.
-
Internationale Abwanderung
Deutsche Fachkräfte wandern zunehmend ins Ausland ab. Das passiert oft wegen besserer Gehälter, attraktiverer Arbeitszeiten oder geringerer Bürokratie. Gleichzeitig gelingt es Deutschland zu selten, gezielt internationale Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu integrieren.
-
Regionale Ungleichverteilung
Während in Großstädten der Fachkräftemangel durch viele Bewerbungen oft ausgeglichen werden kann, kämpfen ländliche Regionen mit akuter Personalnot. Dort sind Jobangebote weniger sichtbar und potenzielle Fachkräfte zögern, umzuziehen.
-
Fehlende Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Ein weiterer Engpass: Viele gut ausgebildete Frauen arbeiten Teilzeit oder gar nicht, oft, weil Betreuungsangebote für Kinder fehlen oder Arbeitszeiten nicht familienfreundlich sind. Hier bleibt viel Potenzial ungenutzt.
Welche Folgen hat der Fachkräftemangel?
Die erste Folge vom Fachkräftemangel ist das Personalproblem. Unternehmen finden keine geeigneten Mitarbeiter für freie Stellen. Das ist jedoch längst nicht das einzige Problem. Die Konsequenzen sind weitreichend:
-
Kein Wachstum
Ohne qualifizierte Mitarbeiter ist kein Ausbau von Geschäftsbereichen und Aufträgen möglich.
-
Hohe Lohnkosten
Fachkräfte werden mit hohen Gehältern angelockt. Für Unternehmen steigen die Kosten für Personal teils drastisch.
-
Mehr Belastung
Fehlen neue Arbeitnehmer, muss die vorhandene Belegschaft mehr Aufgaben und Arbeit übernehmen. Die Belastung für jeden einzelnen wächst.
-
Kaum Innovation
Durch den Fachkräftemangel geht Innovationskraft verloren. Es mangelt an Kompetenzen, neuen Ideen, Perspektiven und auch Geld, das nicht verdient oder für teures Personal investiert wird.
-
Engpässe
Gefährliche Folge gerade in sozialen Berufen. Es kommt zu Engpässen bei der Versorgung in der Pflege oder im Gesundheitsbereich.
-
Verlust an Wettbewerbsfähigkeit
Deutschland verliert im internationalen Vergleich an Boden, wenn Unternehmen nicht mehr ausreichend qualifiziertes Personal finden.
-
Standortverlagerung
Einige Betriebe verlagern ihre Produktion oder Dienstleistungen ins Ausland, wo der Arbeitsmarkt entspannter ist. Das ist ein Risiko für den Standort Deutschland.
-
Ausbildungsdefizit
Auch Ausbilder fehlen, wodurch weniger Nachwuchskräfte nachkommen und sich der Mangel in Zukunft weiter verschärft.
Fachkräftemangel & Corona: Wie hat sich die Lage verändert?
Die Corona-Pandemie hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf den Arbeitsmarkt, auch in Bezug auf den Fachkräftemangel. Während zu Beginn der Krise die wirtschaftliche Unsicherheit für einen spürbaren Rückgang offener Stellen sorgte, hat sich das Bild inzwischen deutlich gewandelt. Heute sprechen Expertinnen und Experten davon, dass sich der Fachkräftemangel nach der Pandemie sogar noch verschärft hat.
Zu Beginn der Pandemie – insbesondere im Frühjahr und Sommer 2020 – verzeichnete Deutschland einen deutlichen Rückgang an unbesetzten Fachkräfte-Stellen. Viele Unternehmen stoppten vorübergehend ihre Neueinstellungen, schickten Mitarbeitende in Kurzarbeit oder strichen geplante Positionen komplett. Die Folge: Die sogenannte Fachkräftelücke halbierte sich von rund 347.000 auf unter 181.000 offene Stellen. Die Gründe dafür:
- Einstellungsstopps in vielen Unternehmen
- Kurzarbeit statt Neueinstellungen
- Unsicherheit durch Lockdowns und Pandemie-Folgen
- Rückläufige Investitionen in Personal
- Wirtschaftlicher Einbruch in vielen Branchen
- Ausbleibende Nachfragen, z.B. im Tourismus, Gastgewerbe, Einzelhandel
- Verschobene oder gestrichene Projekte und Personalbedarfe
Die Entwicklung war nur von kurzer Dauer. Sobald sich die wirtschaftliche Lage ab Ende 2021 stabilisierte, nahm die Nachfrage nach qualifiziertem Personal rapide zu. Seit 2022 beobachten Wirtschaftsinstitute und Arbeitsmarktforscher sogar eine Verstärkung des Mangels: Inzwischen klaffen Angebot und Nachfrage weiter auseinander als vor Corona. Aktuellen Daten zufolge fehlen in Deutschland derzeit rund 530.000 qualifizierte Fachkräfte.
Lösungen gegen den Fachkräftemangel
Schon jetzt ist der Fachkräftemangel ein Problem, in den kommenden Jahren sollen je nach Schätzung und Studie mehr als drei Millionen qualifizierte Arbeitnehmer in Deutschland fehlen. Die entscheidende Frage: Welche Lösungen gibt es?
Politik und Arbeitgeber arbeiten gemeinsam an verschiedenen Wegen. Das Ziel: Nicht nur einzelne Maßnahmen durchführen, sondern ein umfangreiches Paket umsetzen, um den Fachkräftemangel an verschiedenen Stellen zu bekämpfen. Hier sind die wichtigsten Aspekte dabei:
-
Berufe attraktiver machen
Bessere Arbeitsbedingungen, höheres Gehalt und Karrierechancen machen Berufe zu einer attraktiveren Jobwahl. Mögliche Maßnahmen umfassen die Einführung flexibler Arbeitszeiten, besseren Aufstiegschancen und Weiterbildungsmöglichkeiten.
-
Frauen stärker einbinden
Viele Frauen mit Top-Qualifikationen stehen dem Arbeitsmarkt nicht oder nur teilweise zur Verfügung. Hauptsächlich kümmern sich Mütter um Kindeserziehung oder die Pflege von Angehörigen. Es fehlt in vielen Bereichen an einer wirklichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
-
Potenziale besser nutzen
Arbeitssuchende oder Geringqualifizierte haben viel Potenzial, das bisher ungenutzt bleibt. Durch Fortbildungen und Umschulungen werden wichtige Fachkräfte aufgebaut und Personallücken geschlossen. Auch Menschen mit Behinderung entwickeln durch individuelle Qualifizierungsmaßnahmen gefragte Kompetenzen.
-
Fachkräfte international gewinnen
Deutsche Unternehmen brauchen qualifiziertes Personal aus dem Ausland. Schwierigkeiten gibt es hier vor allem auf politischer Ebene. Es braucht Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnis und Anerkennung von Ausbildung oder Qualifikationen.
-
Arbeitskräfte länger binden
Die Frührente von Arbeitnehmern beschleunigt den Fachkräftemangel. Das Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung ermittelte: 1,1 Millionen Arbeitskräfte zwischen 55 und 64 Jahren könnten reaktiviert werden – durch altersgerechte Gestaltung der Arbeit, betriebliches Gesundheitsmanagement und Weiterbildungen.
-
Unternehmenskultur langfristig verbessern
Arbeitgeber bekämpfen den Fachkräftemangel mit einer guten Unternehmenskultur und Employer Branding. Es braucht Wertschätzung für Mitarbeiter, einen transparenten Bewerbungsprozess und respektvollen Umgang mit Kandidaten sowie Angestellten. Gefragte Arbeitgeber ziehen Fachkräfte an.
-
Ausbildung praktischer gestalten
Experten fordern mehr Praxisorientierung in Studiengängen und mehr Informationen zu Ausbildungsangeboten. Das bereitet besser auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vor und stärkt personalschwache Bereiche. Gerade die duale Ausbildung muss wieder stärker in den Fokus rücken, um die Nachfrage in vielen Berufen in den nächsten Jahren zu decken.
-
Bildung digitalisieren und modernisieren
Digitale Kompetenzen sind heute Schlüsselqualifikationen. Eine zeitgemäße Bildungspolitik mit digitalen Lerninhalten, modernen Lehrmethoden und besserer technischer Ausstattung – bereitet junge Menschen gezielter auf den Arbeitsmarkt vor. Auch IT- und MINT-Fächer sollten stärker gefördert werden.
-
Bürokratie abbauen, insbesondere für ausländische Fachkräfte
Viele qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland scheitern an komplizierten Visa-Verfahren, Anerkennungsverfahren oder bürokratischen Hürden. Einfachere Prozesse und zentrale Anlaufstellen würden den Zugang zum Arbeitsmarkt deutlich erleichtern.
-
Regionale Mobilität fördern
In strukturschwachen Regionen herrscht oft hohe Arbeitslosigkeit, während anderswo Fachkräfte fehlen. Anreize wie Wohnkostenzuschüsse, Umsiedlungsbeihilfen oder Remote-Arbeitsmodelle könnten helfen, Fachkräfte besser zu verteilen.
Lösungen zum Fachkräftemangel gelingen nur durch strukturelle Veränderungen in der Politik und Maßnahmen in Unternehmen. Wichtig ist zudem schnelles Handeln, bevor Millionen Arbeitnehmer fehlen.
Checkliste für Unternehmen: So begegnen Sie dem Fachkräftemangel
Eine kompakte Übersicht, wie Arbeitgeber sofort gegensteuern können:
- Zielgruppenanalyse
Welche Fachkräfte fehlen konkret? In welchen Abteilungen? - Attraktivität steigern
Arbeitsbedingungen, Gehalt und Benefits überarbeiten. - Karrierepfade entwickeln
Interne Entwicklung fördern statt externe Suche. - Flexible Arbeitsmodelle anbieten
Homeoffice, Gleitzeit, Teilzeitmodelle. - Gezielte Weiterbildung ermöglichen
Kompetenzen intern aufbauen. - Arbeitgebermarke (Employer Branding) stärken
Unternehmenswerte sichtbar machen. - Bürokratie abbauen
Schnelle, einfache Bewerbungsprozesse schaffen. - Auszubildende fördern
Frühe Bindung ans Unternehmen etablieren. - Internationale Fachkräfte gewinnen
Prozesse für Zuwanderung optimieren. - Diversität fördern
Frauen, Ältere, Menschen mit Behinderung gezielt ansprechen.
Mit einer klaren Strategie und dem Mut zur Veränderung können Unternehmen dem Fachkräftemangel aktiv begegnen und sich langfristig als attraktiver Arbeitgeber am Markt positionieren.
Häufige Fragen und Antworten zum Fachkräftemangel
Die Ursachen sind vielfältig: Demografischer Wandel, ein Rückgang der Ausbildungszahlen, unattraktive Arbeitsbedingungen in manchen Berufen, sowie technologische Entwicklungen und der Wettbewerb um Talente auf dem globalen Arbeitsmarkt. All das führt dazu, dass qualifizierte Fachkräfte in vielen Bereichen fehlen.
Laut aktuellen Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) konnten im Jahr 2024 rund 439.000 Stellen für Fachkräfte nicht besetzt werden. In rund 49 Prozent dieser Fälle handelte es sich um sogenannte Mangelberufe, also Berufe mit besonders wenigen verfügbaren Bewerbern.
Besonders betroffen sind die Pflege- und Gesundheitsberufe, das Handwerk, die IT-Branche, das Ingenieurwesen sowie pädagogische Berufe. Auch in der Logistik, Gastronomie und Baubranche werden vielerorts händeringend Fachkräfte gesucht.
Während der Pandemie wurden zahlreiche Stellen gestrichen, viele Beschäftigte haben Branchen gewechselt oder sich umorientiert. Gleichzeitig sind mehr Menschen in Rente gegangen, während weniger Auszubildende nachkamen. Die Effekte wirken bis heute nach und verstärken strukturelle Schwächen am Arbeitsmarkt.
Die Angaben zum Fachkräftemangel variieren, weil unterschiedliche Institute verschiedene Definitionen und Messmethoden verwenden. Während das IAB nur offene Stellen in offiziell anerkannten Mangelberufen zählt, beziehen andere Quellen wie die Bundesagentur für Arbeit oder das IW auch Fachkräfte mit Studium oder Spezialkenntnissen ein. Zudem basieren einige Zahlen auf Hochrechnungen und Prognosen, andere auf aktuellen Stellenbesetzungsdaten.
Was andere dazu gelesen haben