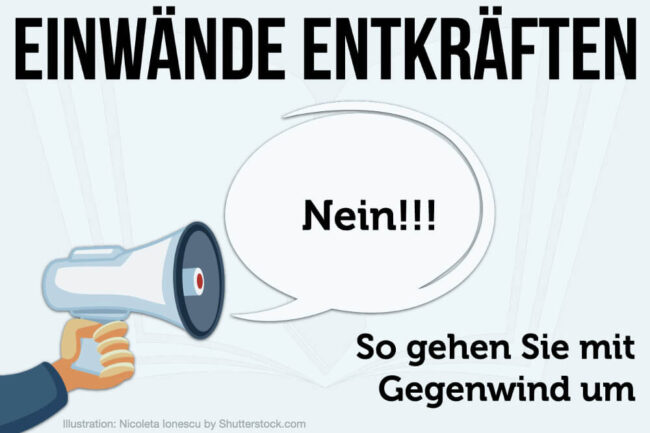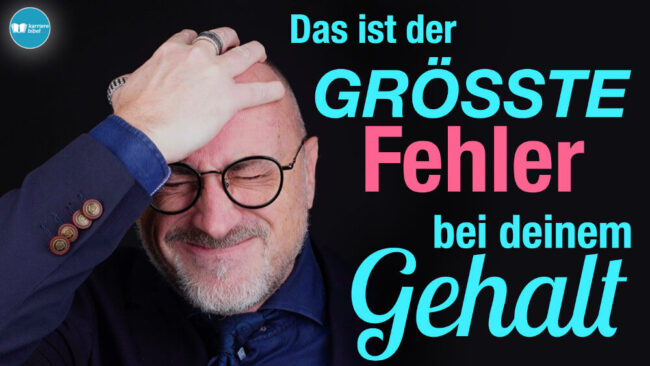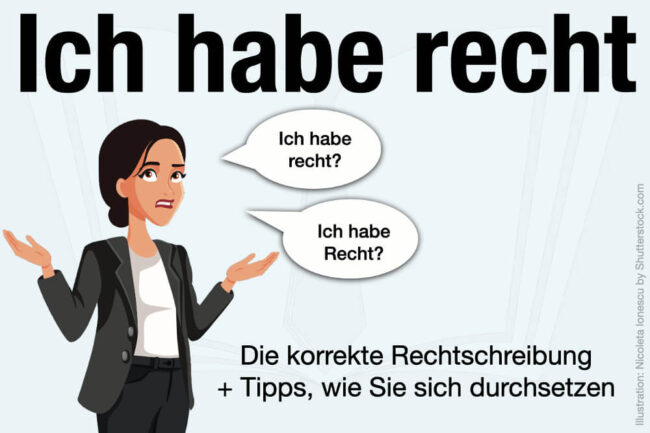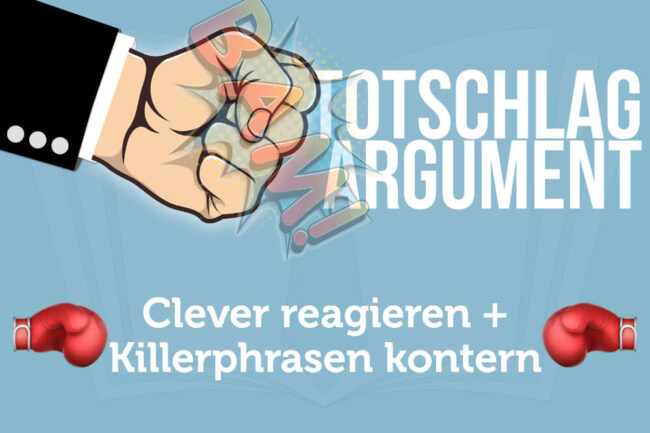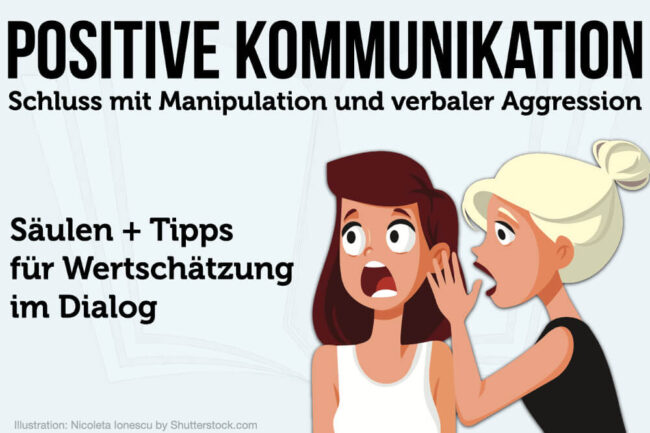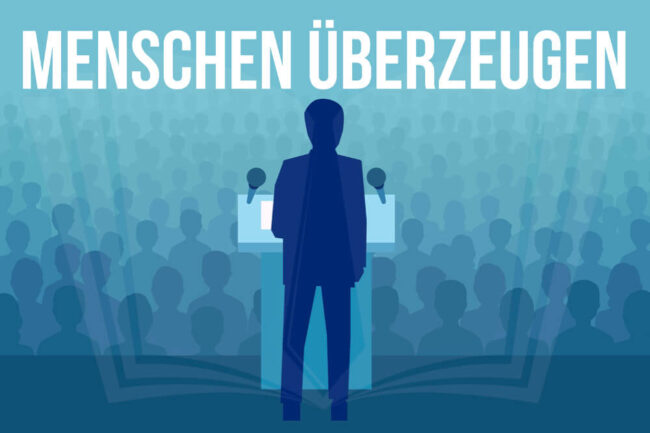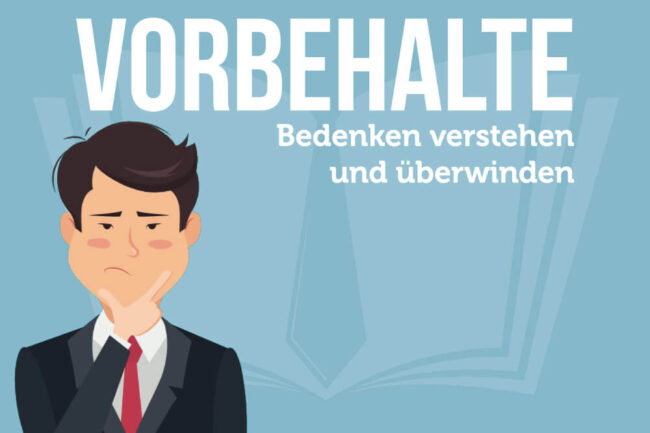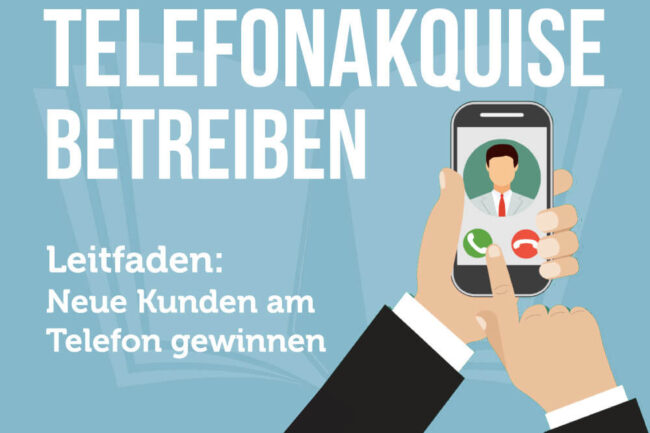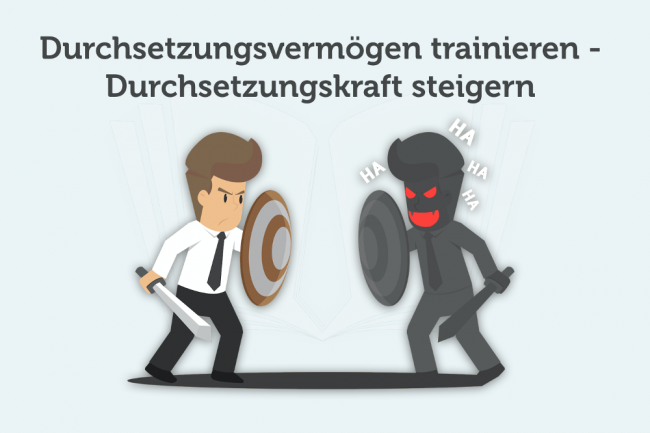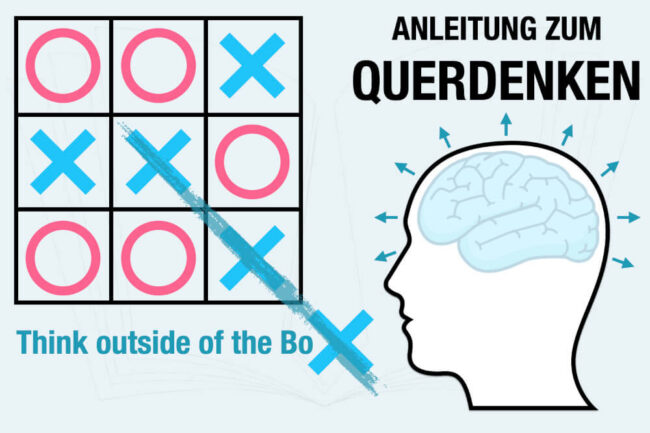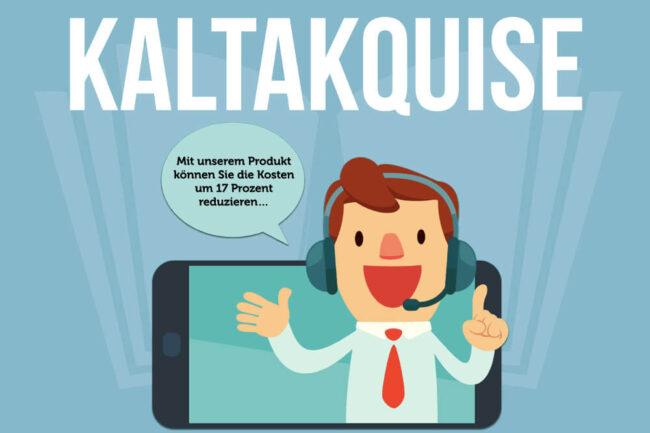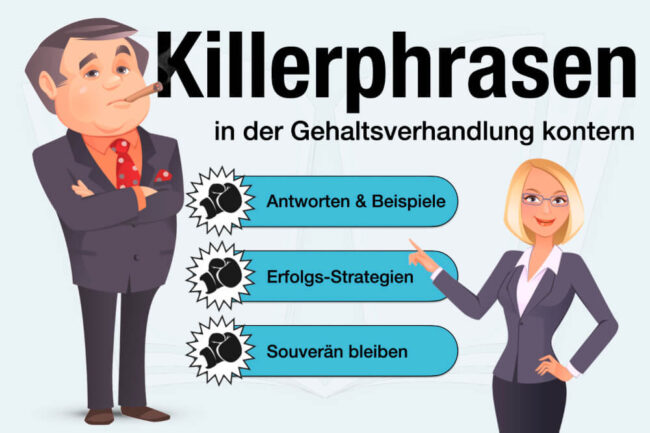Was ist das „Ja, aber“-Syndrom?
Das „Ja, aber“-Syndrom ist eine Kommunikationsstrategie, bei der einer Aussage zugestimmt und gleichzeitig eine Einschränkung oder Gegenargument vorgebracht wird. Es dient als Blockade in der Kommunikation, vermittelt Zurückweisung und verhindert neue Lösungen.
Ein „Ja, aber“ ist ein verstecktes Nein. Die zuerst signalisierte Zustimmung („Ja“) wird sofort wieder zurückgezogen („aber“). „Ja, aber“-Sager nutzen die rhetorische Floskel als Widerstand gegen neue Ideen und Veränderungen – oder um den eigenen Standpunkt durchzubringen.
Ja-aber in der Psychologie
Aus Sicht der Psychologie ist das „Ja, aber“ ein sogenanntes Reaktanz-Verhalten. Betroffene verweigern sich Vorschlägen oder empfohlenen Handlungen. Sie reagieren bei Veränderungen und Innovationen mit Verunsicherung, Angst und Ablehnung. Statt sich darauf einzulassen, liefern Sie sofort Gegenargumente.
Bedeutung Ja, aber-Syndrom: Was macht das mit uns?
Eine Ja,aber-Mentalität betrifft nicht nur andere Menschen, sondern vor allem uns selbst. Wir blockieren nicht nur Vorschläge von anderen, sondern ebenso jede eigene Veränderung und jeden neuen Impuls im Leben. Alles dreht sich um Planbarkeit, Kontrollierbares, Sicherheit und Stabilität.
Für Menschen, die so denken, gibt es keine Chancen, sondern nur Risiken. Das Problem: Eine Ja, aber-Haltung und die entsprechende Verhaltensweise vermitteln nur die Illusion von Kontrolle. Die Wirklichkeit um uns herum ist alles andere als statisch – der Wandel lässt sich dadurch nicht aufhalten.
Eigene Entwicklung blockiert
Ja, aber-Menschen wollen den Status Quo bewahren. Positive Veränderungen bleiben so ungenutzt. Durch Ihre Bedenken blockieren Sie wichtige Entwicklungen und stehen ihrer Entwicklung im Weg.
Betroffene lassen sich nicht inspirieren, geben selbst wenig Impulse und können mit kreativen Lösungen nichts anfangen. Effekt der Haltung: Sie treten auf der Stelle und stehen sich selbst im Weg.
Ja, aber-Syndrom: Was macht es mit anderen?
Im Umgang mit anderen zeigt ein „Ja, aber…“, dass Sie etwas an den Aussagen Ihres Gegenübers bemängeln, richtig stellen oder noch ergänzen müssen. Die anfängliche Zustimmung ist nur vorgetäuscht, weil Sie das Gesagte in Wahrheit ablehnen. Was Sie tatsächlich sagen, ist meist, dass der oder die andere falsch liegt oder etwas Wichtiges vergessen hat.
Damit erzeugen Sie großen Rechtfertigungsdruck für den Gesprächspartner. Oft endet das in einer Konfrontation. Statt lösungsorientierte Ansätze zu diskutieren, entwickeln sich verhärtete Fronten und ein Schlagabtausch, der niemanden weiterbringt. Schnelle Einwände sind kontraproduktiv und bringen fruchtbare Diskussionen zum Erliegen.
Umgang mit Ja, aber-Menschen: Was tun?
Der Umgang mit Ja, aber-Menschen ist frustrierend. Argumentative Verteidigung bringt hier wenig, auch wenn es ein menschlicher Impuls ist. Das Gespräch dreht sich irgendwann nur noch im Kreis. Befinden Sie sich in einer solchen Situation, helfen folgende Tipps:
-
Schauplatz verlassen
Stecken Sie in einem argumentativen Schlagabtausch mit einem Bedenkenträger fest, produzieren Sie keine weiteren Lösungen und argumentieren Sie nicht weiter. Meistens bringt das nichts. Ihr Gegenüber will seine Komfortzone nicht verlassen und kann nicht über seinen Schatten springen. Gehen Sie erst einmal aus der Situation heraus, brechen Sie eine Diskussion ab und vertagen Sie das Thema.
-
Verständnis zeigen
Eventuell will der Gesprächspartner nur ernst genommen werden. In manchen Situationen kann es sinnvoll sein, Verständnis für die Position des anderen zum Ausdruck zu bringen. Idealerweise bringen Sie den vorgebrachten Einwand mit Ihrer eigenen Position in Verbindung. Dies kann Gesprächspartner ermutigen, auch auf Ihre Vorschläge zur Lösung einzugehen. Nutzen Sie Formulierungen wie: „Ich habe Ihr Problem verstanden und wollte nur etwas zur Lösung beitragen.“
-
Wertschätzung entgegenbringen
Die Verknüpfung von vorgebrachtem Einwand und eigener Position können Sie durch den Ausdruck „Gerade weil…“ gut verbinden. Das zeigt Wertschätzung und mit weiteren positiven Formulierungen lassen sich Einwände weiter entkräften.
„Ja, aber“-Mentalität selber ablegen
Neigen Sie selbst zu einer Ja-aber-Haltung? Wenn Sie dieses Denken ausmacht, gibt es effektive Tipps, um es wieder abzulegen:
- Stellen Sie Ihre Erwartungen weniger in den Fokus. So bleiben Sie offen für neue Ansätze und erkennen Möglichkeiten, die Sie bisher nicht gesehen haben.
- Seien Sie nicht immer emotional beteiligt. Je emotionaler Sie sind, desto schlechter können Sie sich mit anderen Positionen auseinandersetzen. Eine entspannte (und sachliche) Haltung ist eine gute Basis für eine offene Diskussion.
- Nehmen Sie sich vor, weniger schnell eine Meinung zu fällen und offen für gegenteilige Meinungen zu sein. Lassen Sie sich von guten Argumenten überzeugen.
- Bitten Sie um Feedback: Was habe ich übersehen? Denken andere auch so? Schaffe ich ein Problem oder ist da wirklich eines? Was denkt, fühlt, sieht ein anderer? Vielleicht finden Sie es in manchen Fällen auch angenehm, gar keine Meinung zu haben.
- Versuchen Sie zu ergründen, warum Sie Einwände haben. Ist es eigene Verunsicherung und Angst vor Veränderung oder haben Sie wirklich gute Argumente?
„Ja, aber“ versus „Ja, und“ – Rhetorische Tipps
Wir sind geneigt, alles Gesagte vor einem „aber“ zu ignorieren. Dadurch werden positive Aspekte in der Kommunikation einfach überhört. Durch das „aber“ wird die Aufmerksamkeit auf den folgenden Satzteil gelenkt – ein Aber grenzt ab. Ersetzen Sie es durch ein „Ja, und“ oder auch durch ein „Nein“. Mit einem „Ja, und“ können Sie gegensätzliche Positionen verbinden und erhöhen die Chance, dass Ihre Nachricht auf offene Ohren stößt.
Gleichzeitig können Sie Ihre eigene Position vertreten. Wollen Sie hingegen Nein sagen, dann tun Sie dies auch. Wenn Sie das wirklich wollen, bleiben Sie auch damit Ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen treu und vermeiden unnötigen Stress.
Beispiel für bessere Formulierungen
Die neue Einstellung und Formulierung können Sie in jeder Situation nutzen. Hier ein kurzes, einfaches Beispiel, wie Sie ein „aber“ vermeiden. Die Frage: „Können Sie mir in dieser Angelegenheit helfen?“
Mögliche Antworten:
❌ „Ja, aber ich habe gerade keine Zeit.“
✅ „Ja, ich kümmere mich darum, sobald ich Zeit habe.“
✅ „Nein, fragen Sie bitte den Kollegen XY – vielleicht hat er Zeit zu helfen.“
Was andere dazu gelesen haben