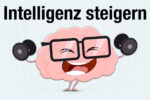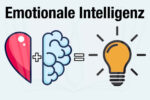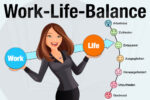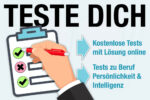Definition: Was ist Reziprozität?
Reziprozität beschreibt ein grundlegendes Prinzip im zwischenmenschlichen Verhalten, das auf Gegenseitigkeit (auch: Wechselbezüglichkeit) beruht. Es lässt sich am besten mit den Redewendungen beschreiben:
In der Psychologie und Soziologie bezeichnet Reziprozität die Tendenz, das Verhalten anderer Menschen in ähnlicher Weise zu erwidern – also zum Beispiel auf einen Gefallen mit einem Gefallen zu reagieren.
Formen der Reziprozität
Generell werden fünf Formen der Reziprozität unterschieden:
- Positive Reziprozität
Menschen belohnen oder erwidern freundliches und großzügiges Verhalten. - Negative Reziprozität
Menschen beantworten unfaires Verhalten durch Bestrafung. - Direkte Reziprozität
Ein klassischer Tauschhandel: Eine Leistung für eine Gegenleistung. - Indirekte Reziprozität
Altruistisches Verhalten erhöht die Reputation des Gebers, ohne direkte Gegenleistung. - Generalisierte Reziprozität
Erwartung, dass eine Leistung oder ein Gefallen zu einem späteren Zeitpunkt belohnt wird.
Reziprozität spielt eine wichtige Rolle in sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen. Dahinter steckt der Wunsch nach Balance und ausgeglichener Fairness. Gleichzeitig will niemand ausgenutzt werden.
Wortherkunft und Bedeutung
Der Begriff „Reziprozität“ stammt vom Lateinischen „reciprocare“ und bedeutet übersetzt so viel wie „hin- und zurückfließen“. Auf konkrete Handlungen übertragen, bezeichnet reziprokes Verhalten, etwas in gleicher Weise zu erwidern.
Häufige Synonyme sind: Gegenseitigkeit, Wechselseitigkeit oder Wechselbeziehung.
Reziprozität Beispiele im Alltag
Das Reziprozitätsprinzip spielt im Alltag regelmäßig eine große Rolle und beeinflusst unser Verhalten, ohne das uns das bewusst ist. Hier einige Reziprozität Beispiele:
-
Komplimente
In der Kommunikation zeigt sich Reziprozität besonders häufig. Bekommen wir zum Beispiel ein Kompliment, geben wir gerne eines zurück – selbst wenn wir vorher nicht daran gedacht haben.
-
Hilfe
Der Kollege springt uns bei einem Projekt zur Seite oder ein Freund hilft beim Umzug. Klar, dass wir uns dafür bei passender Gelegenheit revanchieren und ebenfalls helfen.
-
Gehaltsverhandlung
Reziprozität zwingt zu Zugeständnissen – etwa in der Gehaltsverhandlung: Sobald eine Seite einen Kompromiss anbietet, fühlt sich die andere Seite moralisch verpflichtet, sich ebenfalls zu bewegen. Deshalb werden bei Tarifverhandlungen anfangs immer überhöhte Forderungen gestellt – um davon später Abstriche machen zu können!
-
Geschenke
Erhalten wir ein Geschenk zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ist es für viele selbstverständlich, demjenigen ebenfalls etwas zu schenken.
-
Werbung
Das Marketing hat die Macht der Reziprozität längst erkannt und nutzt sie, um Kunden zum Kauf zu verführen. Typische Beispiele sind kostenlose Kostproben im Supermarkt. Dahinter steht keine Großzügigkeit: Wer kräftig zulangt, fühlt sich anschließend zu Kauf verpflichtet.
⇨ Lesen Sie dazu auch: Die Tricks der Verkaufspsychologie
Reziprozität Psychologie: 5 Effekte
Reziprokes Verhalten ist fest in uns Menschen verankert. Die obigen Beispiele zeigen, dass wir aufgrund der Gegenseitigkeit oft unbewusst reagieren und genau das tun, was andere wollen.
Um mittels Reziprozität Psychologie nicht manipuliert zu werden, sollten Sie verstehen, wie sie wirkt und welche Effekte dahinter stecken…
-
Schuldgefühle
Reziprozität erzeugt vor allem Schuldgefühle: War jemand nett zu uns, haben wir das Gefühl, der Person etwas schuldig zu sein. Um das schlechte Gewissen zu beruhigen, versuchen wir die Schuld so schnell wie möglich zu begleichen.
-
Sympathie
Freundliche Menschen sind uns ohnehin schon sympathisch. Verstärkt wird das, wenn wir um einen Gefallen gebeten werden. Hier wirkt der sogenannte Benjamin-Franklin-Effekt: Danach finden wir Menschen sympathischer, denen wir einen Gefallen getan haben.
-
Selbstwertgefühl
Reziprokes Verhalten steigert das Selbstwertgefühl. Es beweist, dass wir nützliche Fähigkeiten besitzen, mit denen wir anderen weiterhelfen können. Das aber lässt sich ausnutzen: Schon ein kleiner Gefallen reicht, um im Gegenzug von Menschen mit Helfersyndrom eine große Gegenleistung einzufordern.
-
Sozialgefühl
Reziprozität ist ein globales Phänomen und eine normative Vorstellung (sog. Reziprozitätsnorm). Als soziales Wesen streben Menschen danach, zu tun, was normal ist und gesellschaftliche Moralvorstellungen erfüllt. Um weiterhin dazuzugehören, passen wir unser Verhalten an und tun, was wir glauben, dass andere erwarten.
-
Schutzmechanismus
Nahezu alle Menschen haben sensible Antennen dafür, dass sich Geben und Nehmen die Waage halten. Gerät die Gegenseitigkeit aus dem Gleichgewicht, ändern wir unser Verhalten – zum Beispiel, um nicht ausgenutzt und übervorteilt zu werden. Es setzt eine Art Abwehr- oder Bestrafungsmechanismus ein, mit dem wir zeigen: „Du handelt nicht fair!“
Wie kann ich mich vor Reziprozität schützen?
Die Reziprozität Beispiele und Psychologie dahinter zeigen, dass das Gegenseitigkeitsprinzip ebenso Nachteile hat und etwa gezielt dazu genutzt werden kann, um Menschen zu manipulieren. Fachleute sprechen auch von der „Gefälligkeitsfalle“ – was tun?
Natürlich steckt nicht hinter jeden netten Geste gleich ein böswilliger Manipulationsversuch! Gleichzeitig sollten Sie sich bewusst machen, ob und wann Sie manipuliert werden. In dem Fall haben Sie drei Optionen, wie Sie reagieren:
- Machen Sie sich bewusst, dass Reziprozität als Manipulationstechnik eingesetzt wird.
- Erkennen Sie Muster und hinterfragen Sie, ob jemand Ihnen etwas gibt oder für Sie tut, weil er oder sie eine Gegenleistung erwartet.
- Achten Sie auf Personen, die sich ständig bei Ihnen einschleimen oder Ihnen ungefragt Dinge schenken.
- Bewerten Sie Ihre Gefühle und unterscheiden Sie zwischen Dankbarkeit und Pflichtgefühl.
- Handeln Sie nie aus einem Schuldgefühl heraus!
- Stärken Sie Ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, um sich vor Manipulation zu schützen.
- Prüfen Sie Ihre Motive: Würden Sie etwas tun oder kaufen, wenn Sie kein Geschenk erhalten hätten?
- Reflektieren Sie über die Balance Ihrer Beziehung: Sind das Geben und Nehmen ausgeglichen?
- Holen Sie eine zweite Meinung ein: Wie vertrauenswürdig und seriös ist Ihr Gegenüber?
- Setzen Sie klare Grenzen und lernen Sie, höflich aber bestimmt „Nein“ zu sagen.
- Lassen Sie sich Bedenkzeit, bevor Sie auf eine nette Geste reagieren.
- Lehnen Sie Gefälligkeiten ab, wenn Sie den Verdacht haben, dass sie mit Hintergedanken angeboten werden.
- Sprechen Sie die Gefälligkeitsfalle offen an: „Ich möchte aber nicht in deiner Schuld stehen!“ Allein diese Aussage neutralisiert, dass Sie sich später zu einer Gegenleistung gezwungen fühlen. Umgekehrt können Sie sagen, dass Sie im Gegenzug nichts erwarten.
Bewusstsein schaffen
Emotionen kontrollieren
Hintergrund analysieren
Besonnenheit wahren
Bedeutung: Wie wichtig ist Reziprozität?
Auch wenn die Reziprozität einige Nachteile hat und zur Manipulation missbraucht werden kann, ist sie dennoch unverzichtbar. Das Gegenseitigkeitsprinzip stellt eine Grundregel der menschlichen Interaktion dar. Ohne sie gerät das soziale Miteinander aus der Balance – mit zahlreichen negativen Folgen:
-
Konfliktpotenzial
Fehlt in Beziehungen eine gesunde Balance aus Geben und Nehmen, drohen Frustration und enormes Konfliktpotenzial: Niemand lässt sich das lange gefallen oder mag es, ausgenutzt zu werden.
-
Selbstzweifel
Werden Gefallen nicht erwidert, bekommen einige Menschen Selbstzweifel und fragen sich: „Habe ich was falsch gemacht?“ – zum Beispiel, wenn man stets freundlich ist, aber immer auf Ablehnung stößt.
-
Trennungen
Reziprozität ist ein soziales Schmiermittel und sorgt dafür, dass sich Beziehungen gut und fair anfühlen. Fehlt das Gefühl der Gegenseitigkeit, kommt es in letzter Konsequenz zur Trennung. Das gilt im Privatleben genauso wie in der Wirtschaft: Asymmetrische Geschäftsbeziehungen halten selten lange.
Letztlich sollte Ihre Entscheidungen immer auf eigenem, freien Willen basieren und nicht auf dem künstlich erzeugten Gefühl der Verpflichtung. Eine gesunde Skepsis hilft. Im Kern bleibt Reziprozität aber eine gute Sache, die Menschen verbindet.
Was andere dazu gelesen haben