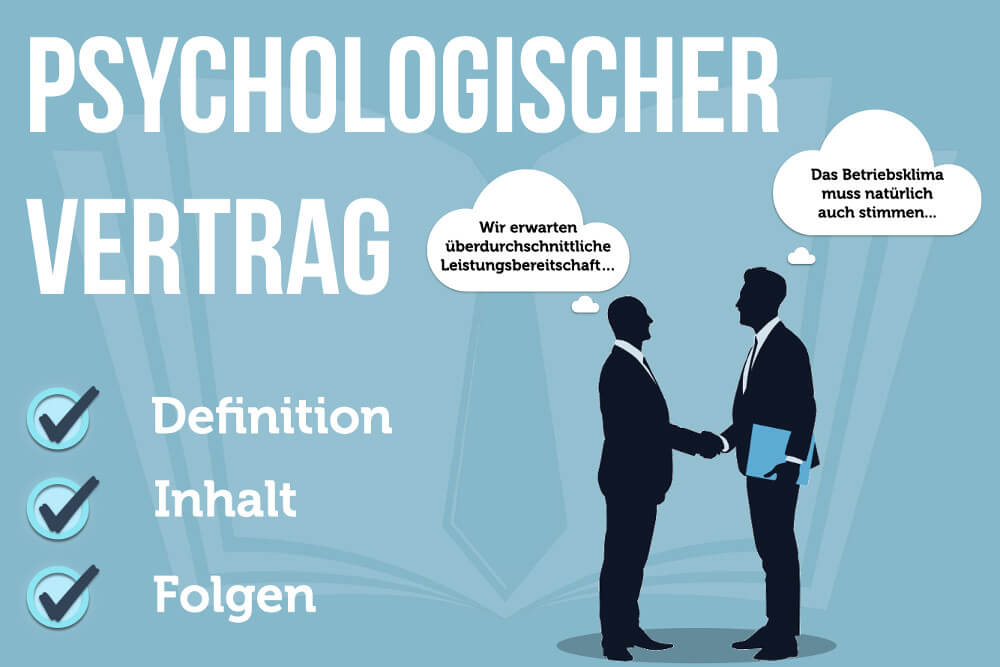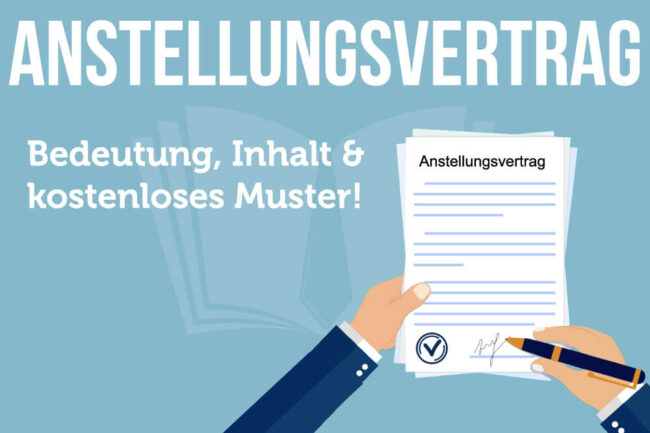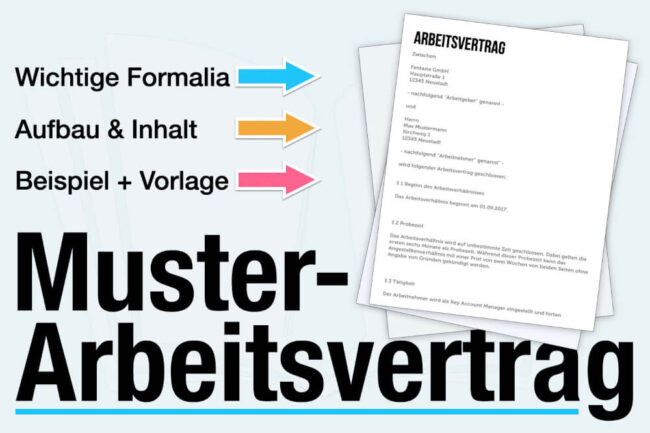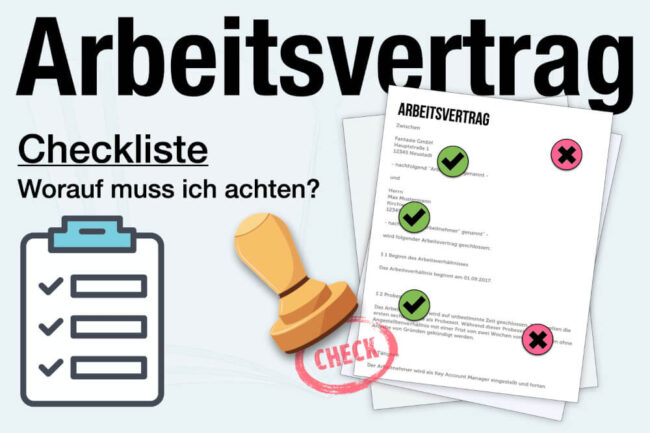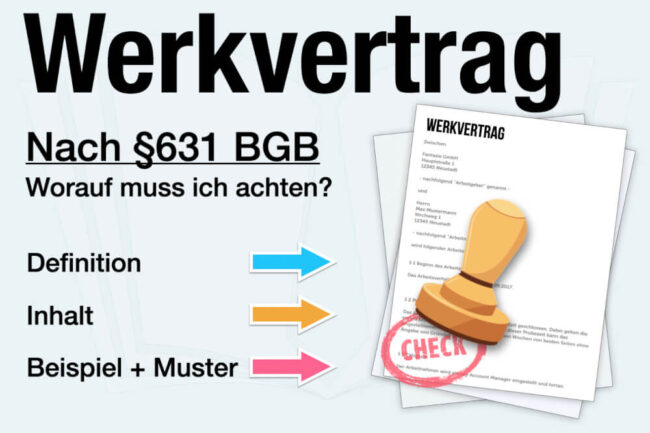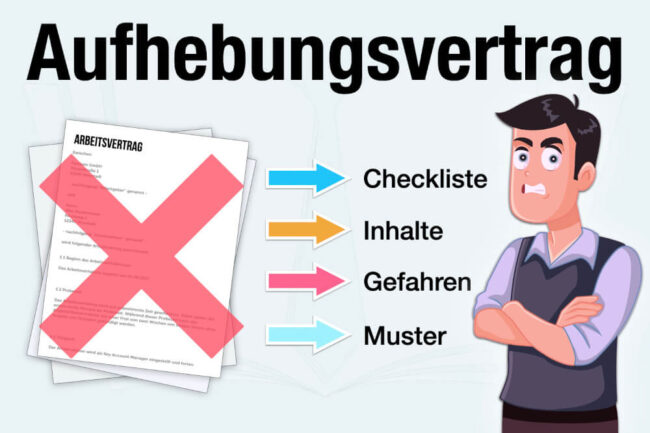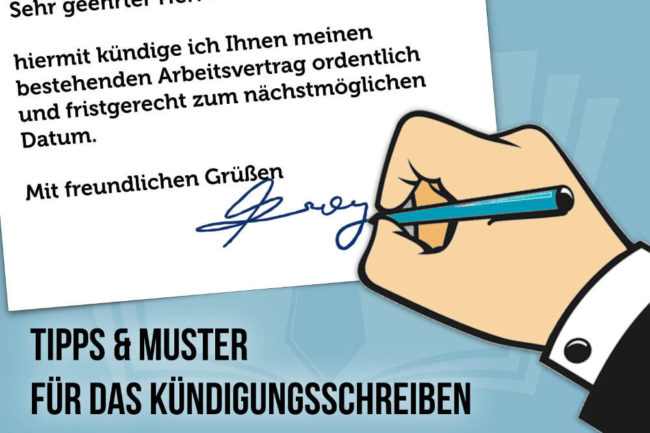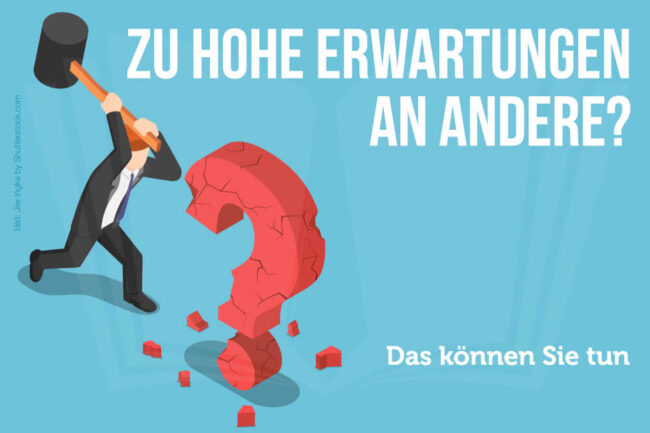Psychologischer Vertrag Definition: Was ist das?
Als psychologischer Vertrag werden die gegenseitigen Erwartungen und Verpflichtungen von Mitarbeiter und Arbeitgeber bezeichnet, die über die im Arbeitsvertrag schriftlich fixierten Leistungen hinausgehen. Es handelt sich nicht um einen juristisch wirksamen Vertrag im eigentliche Sinne. Vielmehr sind es die konkreten Vorstellungen zur Zusammenarbeit, die beide Seiten mitbringen und erfüllt sehen wollen.
Auch ohne schriftliche Vereinbarung prägt ein psychologischer Vertrag das Arbeitsverhältnisse und die Beziehung zwischen Angestellten und Unternehmen. Arbeitsleistung, übernommene Aufgaben und Verantwortungen, Betriebsklima, aber gerade auch Zufriedenheit, Motivation und Loyalität werden stark durch den psychologischen Vertrag beeinflusst.
Psychologischer Vertrag: Rousseau und Argyris
Bekanntheit erlangte der psychologische Vertrag in den 1990er Jahren durch mehrere Arbeiten und Veröffentlichungen der amerikanischen Psychologin und Professorin Denise M. Rosseau. Sie beschäftigte sich in erster Linie mit den Auswirkungen des Arbeitswandels auf die Einstellung und Erwartungen der Mitarbeiter.
Das Konzept des psychologischen Vertrages geht jedoch bis in die 1960er Jahre zurück. Hier entwickelte Chris Argyris, Professor für Verwaltungswissenschaften, die Grundidee einer solch impliziten Abmachung innerhalb des Arbeitsverhältnisses. Er sprach dabei von einer stillschweigenden Übereinkunft.
Inhalt: Was umfasst ein psychologischer Vertrag?
In einem psychologischen Vertrag können zahlreiche Vorstellungen enthalten sein, die Mitarbeiter als auch Arbeitgeber an die Zusammenarbeit haben. Diese unterscheiden sich von den klassischen Inhalten im Arbeitsvertrag: Es geht nicht um direkt zugewiesene Aufgaben, das Gehalt oder die Arbeitszeiten.
Der psychologische Vertrag umfasst meistens Erwartungen zu Arbeitsbedingungen, dem Betriebsklima, dem Verhalten des Arbeitgebers, der Leistungsbereitschaft der Belastung durch die Arbeit. Dabei haben beide Seiten sehr unterschiedliche Vorstellungen.
Psychologischer Vertrag für Arbeitnehmer
- Gutes Betriebsklima
- Respektvolle Atmosphäre
- Gute Führungsqualitäten
- Sinnvolle Tätigkeit
- Förderung durch den Arbeitgeber
- Aufstiegsmöglichkeiten
- Spannende Aufgaben
- Angemessene Anforderungen (keine Über- / Unterforderung)
- Verständnisvolle Vorgesetzte
Psychologischer Vertrag für Arbeitgeber
- Selbstständiges Arbeiten
- Verantwortungsbewusstsein
- Leistungsbereitschaft
- Teamfähigkeit
- Informationsbeschaffung
- Problemlösungskompetenzen
- Handeln im Sinne des Arbeitgebers
- Qualifikationsausbau
- Loyalität
Wandel des psychologischen Vertrages
Durch die großen Veränderungen in der Arbeitswelt hat sich über die Jahrzehnte auch der psychologische Vertrag gewandelt. Anfangs wurde von einer vergleichsweise simplen Erwartungshaltung ausgegangen: Mitarbeiter erfüllen ihre Aufgaben und sind dem Arbeitgeber gegenüber loyal – dafür werden sie vom Unternehmen langfristig beschäftigt und erhalten eine (implizite) Jobgarantie.
In der modernen Arbeitswelt sind die Erwartungen vielschichtiger und komplexer. Von Arbeitnehmer wird erwartet, dass Sie zum Unternehmenserfolg beitragen, sich aktiv in Problemlösungen einbringen und sich langfristig weiterentwickelt und auch seine Kompetenzen immer weiter ausbaut.
Mitarbeiter erwarten, dass im Unternehmen ihre Employability – also ihre Beschäftigungsfähigkeit – gefördert wird. Dies ist dem Fakt geschuldet, dass Kaminkarrieren der Vergangenheit angehören. Laufbahnen sind geprägt von Arbeitgeberwechseln. Hier wollen Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt gefragt bleiben. Wichtig ist zudem der Sinn der eigenen Tätigkeit sowie Flexibilität, die zunehmend gesucht und erwartet wird.
Zusammenarbeit verändert psychologische Verträge
Ein psychologischer Vertrag entsteht mit Beginn der Zusammenarbeit. Sobald Sie den schriftlichen Vertrag unterschreiben, haben sowohl Sie als auch Ihr Arbeitgeber zusätzliche Vorstellungen, die nicht explizit in einem Absatz geregelt sind. Diese sind nicht endgültig. Mit längerer Betriebszugehörigkeit und Zusammenarbeit verändert sich Ihre Erwartungshaltung.
Das gilt auch für den Arbeitgeber. Mit der Dauer der Beschäftigung werden die Erwartungen meist deutlich größer – auch wenn die tatsächliche Leistungspflicht laut Arbeitsvertrag unverändert bleibt. Für solche Veränderungen kann es mehrere Ursachen geben:
-
Erfolge
Sie sind motiviert, hängen sich in jede Aufgabe rein und machen auch Überstunden, um Projekte erfolgreich innerhalb der Deadline abzuschließen. Ihr Chef freut sich über die guten Leistungen, doch entstehen daraus auch neue Erwartungen.
Jeder Erfolg setzt die Messlatte höher. Wenn Sie über Monate zu den Leistungsträgern gehört haben, will Ihr Chef das weiterhin sehen. Sein psychologischer Vertrag hat sich angepasst, auch wenn Ihre Jobbeschreibung gleich ist.
-
Selbstwert
Mit beruflichem Erfolg und Betriebszugehörigkeit wächst oftmals auch der Selbstwert und es entsteht ein positives Selbstbild. Sie wissen, dass Sie gut sind und sind stolz auf Ihre Leistungen. Für diese wollen Sie im Job auch respektiert und geschätzt werden.
Die Erwartung entsprechende Anerkennung wird Teil Ihres psychologischen Vertrages.
-
Prioritäten
Mit der Zeit ändern sich Ihre Ansichten, Vorstellungen und Prioritäten. Nach einigen Jahren haben Sie möglicherweise ganz andere Ansprüche an den eigenen Job – und erwarten, dass Ihr Arbeitgeber diese erfüllt. Das können Aufstiegsmöglichkeiten aber ebenso die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sein.
Diese Entwicklungen lassen sich anfangs nicht einschätzen. Sie sind jedoch unausweichlich und kein psychologischer Vertrag kommt an ihnen vorbei.
-
Erfahrungen
Beide Seiten machen in der Zusammenarbeit viele Erfahrungen, durch die ein psychologischer Vertrag geprägt und verändert wird. Der Chef ruft nach Feierabend an und Sie antworten – es entsteht die Erwartung großer Erreichbarkeit. Sie werden gefördert und erhalten regelmäßiges Feedback – davon gehen Sie dann auch in Zukunft aus.
Jedes Verhalten kann die Erwartungshaltung verändern. Wir gehen von gleichbleibendem Verhalten und Umständen aus. Schwierig wird es, wenn sich Verhaltensweisen ändern.
Psychologischer Vertrag: Mitarbeiterbindung im Fokus
Für Unternehmen ist der psychologische Vertrag von großer Bedeutung und sollte keinesfalls ignoriert werden. Die Herausforderung: Anders als der Arbeitsvertrag, bei dem die Inhalte und Verpflichtungen für beide klar ersichtlich sind, ist ein psychologischer Vertrag höchst individuell und subjektiv. Unternehmen wissen oftmals gar nicht um die impliziten Erwartungen, die Mitarbeiter an die Zusammenarbeit haben.
So kann es zum Bruch des psychologischen Vertrages kommen. Arbeitnehmer haben klare Vorstellungen, was ein Arbeitgeber leisten muss und soll – die Erwartungen werden nicht erfüllt. Merken Mitarbeiter diese Diskrepanz, kommt es zu spürbaren Konsequenzen:
-
Sinkende Zufriedenheit
Bei kleineren Brüchen von psychologischen Verträgen sinkt zunächst die Zufriedenheit von Mitarbeitern im Job. Die Arbeit erfüllt Ihre Erwartungen nicht (mehr) oder Sie haben das Gefühl, Ihr Chef würden Sie nicht so behandeln, wie Sie es verdienen. Der Spaß geht verloren und Sie sind zunehmend genervt.
-
Nachlassendes Engagement
Mit der Zeit lässt Ihr gesamtes Engagement am Arbeitsplatz nach. Sie stehen nicht mehr so sehr hinter Ihrem Arbeitgeber, geben sich nicht mehr dieselbe Mühe und bringen kaum noch Leidenschaft für Ihre Arbeit mit.
-
Innere Kündigung
Eine leider häufige Folge bei einem Bruch des psychologischen Vertrags: Es kommt zur inneren Kündigung der Mitarbeiter. Die Motivation ist auf dem Nullpunkt, es wird nur noch die Zeit im Job abgegessen und das absolut Nötigste erledigt. Auch die Loyalität zum eigenen Arbeitgeber ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vorhanden.
Mit Blick auf die Mitarbeiterbindung sollten Personalabteilungen die Erwartungshaltung nicht aus den Augen verlieren.
Psychologischer Vertrag: Kommunikation ist Grundvoraussetzung
Der wichtigste Aspekt ist offene und fortlaufende Kommunikation. Diese ist Grundvoraussetzung, um die gegenseitigen – impliziten – Erwartungen an das Arbeitsverhältnis zu verstehen. Regelmäßige Gespräche, in denen nicht nur Arbeitgeber Feedback geben, sondern auch Mitarbeiter ihre Sicht der Dinge schildern können, sind eine gute Maßnahme, um dies zu erreichen.
Was andere Leser dazu gelesen haben
- Erwartungshaltung: Wie Ambiguitätstoleranz Ihren Erfolg beeinflusst
- Mitarbeiterzufriedenheit: Tipps zum Messen und Steigern
- Jobzufriedenheit: Worauf kommt es an?
- Karriereziele definieren: Was will ich wirklich erreichen?
- Arbeitszufriedenheit: Definition, Faktoren, Tipps