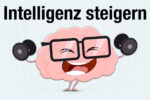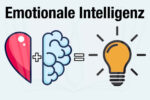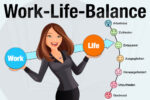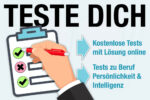Definition: Was versteht man unter einem Außenseiter?
Außenseiter sind die, die nicht dazugehören und abseits am Rand stehen. Sie sind zwar Teil einer sozialen Gruppe, aber nicht voll in die Gemeinschaft integriert. Entweder ist die Außenseiterrolle selbst gewählt oder die Betroffenen werden aufgrund abweichender Eigenheiten oder Verhaltensweisen von den anderen gemieden – zum Beispiel in der Mittagspause (siehe Obelix-Effekt).
Im Sport beschreibt der Begriff „Außenseiter“ einen Wettkampfteilnehmer, dessen Siegeschancen als gering eingeschätzt werden – was gar nicht schlecht sein muss (siehe: Underdog-Effekt).
Synoyme: Wie nennt man Außenseiter noch?
Häufige Synonyme für Außenseiter sind: Eigenbrötler, Einzelgänger, Exzentriker, Individualisten, Nonkonformist, Underdog, Sündenbock oder Aussteiger.
Was macht Menschen zum Außenseiter?
Außenseiter widersprechen im Wesentlichen den Erwartungen und dem Selbstbild der Gemeinschaft. Das können abweichende Verhaltensmuster oder eine bestimmte Attitüde sein. Ebenso die Art sich zu kleiden oder zu sprechen – zum Beispiel einen besonderen Dialekt – ein abnormes Aussehen oder spezielle Marotten.
Zum Außenseiter wird man, indem man sich durch irgendetwas vom Rest der Gruppe auffällig unterscheidet: Äußerlichkeiten, Interessen, Hobbys… Teils geraten Betroffene auch ohne eigenes Zutun in die Außenseiterrolle. Einfach nur, weil sie zum Beispiel aus einem sozialen Milieu oder einer fremden Kultur stammen. Das ist dann allerdings schon eine Form der Diskriminierung.
Abweichler oder Trendsetter?
Das Stigma „Außenseiter“ kann eine Vielzahl an Gründen haben. Teils spielen in der Schule oder im Job auch Gefühle wie Neid, Rivalität und Eifersucht hinein.
Außenseiter zu sein, muss gar nichts Schlechtes sein. Es kann auch bedeuten, seiner Zeit voraus zu sein – eine Art Trendsetter. Wobei der eigene Stil eben noch nicht Mainstream ist und daher als fremd und Abweichung von der Norm empfunden wird. Die Gruppendynamik ändert sich aber, sobald das Markenzeichen in der Masse ankommt oder viele Nachahmer findet. Dann gelten ehemalige Außenseiter plötzlich als coole Vorreiter.
Wie fühlen sich Außenseiter?
Menschen sind soziale Wesen und brauchen daher die Gemeinschaft und Gesellschaft anderer. Das gilt auch für schüchterne oder introvertierte Menschen. Wer nicht unbedingt ein Einzelgänger ist, für den fühlt sich die Außenseiterrolle nicht gut an.
Psychologische Studien zeigen, dass Ausgrenzung und als Außenstehender dazustehen, dieselben Gehirnareale aktiviert wie körperlicher Schmerz. Das Gefühl, einsam oder irgendwie „anders“ zu sein, tut weh, stumpft ab und kann auf Dauer sogar psychisch krank machen.
Typische Folgen und Reaktionen in der Außenseiterrolle:
- Selbstzweifel („Warum gehöre ich nicht dazu?“)
- Überspielen („Mir geht es gut damit.“)
- Verleugnen („Ich will gar nicht dazugehören!“)
- Trotz („Ihr seid selber doof!“)
- Aggression („Euch werd‘ ich es noch zeigen!“)
- Rückzug („Dann eben nicht.“)
- Resignation („Niemand mag mich.“)
Auch körperliche Gewalt kann die Folge sein, wenn Menschen in die Außenseiterrolle gedrängt werden. Die Frustration und Ohnmachtsgefühle werden dann durch verbale oder körperliche Aggressionen sowie destruktive Gewalt (gegen Menschen oder Sachen) kompensiert.
Was anfangs noch mit Witzen oder dem Verhalten als „Klassenclown“ überspielt wird, kann schließlich in sozialer Isolation und einer Depression enden.
Hat es auch Vorteile Außenseiter zu sein?
Manche Menschen fühlen sich, als würden sie nirgendwo richtig reinpassen oder dazugehören. Dabei hat, Außenseiter zu sein, tatsächlich einige Vorteile: Hinter den Outsidern verbergen sich häufig Menschen mit starken Werten, einer klaren Haltung und Moral. Indem Sie nicht bei allem mitmachen, beweisen sie Rückgrat und mentale Stärke. Mitläufer leben deutlich leichter.
Viele Eigenbrötler sind in der Lage, sich Wissen und neue Fähigkeit autodidaktisch anzueignen. Deshalb sind sie zugleich weniger auf die Ratschläge oder Hilfe anderer angewiesen. Das gibt ihnen mehr Freiheit und geistige Unabhängigkeit.
Weil sie oft stille Beobachter sind, bekommen sie mehr mit als andere, sind großartige Zuhörer und häufig exzellente Ratgeber, weil sie eine andere Perspektive auf die Dinge haben als „Insider“ und der Mainstream. Nicht wenige Außenstehende sind bewusste Nicht-Anpasser – nicht aus Renitenz, sondern aus Überzeugung und Autonomie. Macken erfordern Mut – und sind genau deshalb ein Zeichen von Stärke.
Außenseiter im Job: Was tun?
Auch in Unternehmen und Teams gibt es immer wieder Außenseiter – freiwillige und unfreiwillige. Das kann nicht nur für Betroffene eine enorme Belastung sein. Auch spricht es nicht für den Teamgeist, wenn es einen oder mehrere Außenseiter gibt.
Führungskräfte und Teamleiter sollten zunächst die Ursachen erforschen: Handelt es sich hierbei um aktive Ausgrenzung durch die Kollegen, um Mobbing – oder um bewusste Selbst-Abschottung des Einzelnen? Nicht alle Außenseiter sind automatisch Störenfriede – manche Menschen fühlen sich wohler, wenn sie weitestgehend alleine arbeiten können (siehe: Hochsensibilität).
Vom Gespräch zur Fürsorgepflicht
In jedem Fall sollten Vorgesetzte mit den Außenseitern das 4-Augen-Gespräch suchen und das Problem im Team ansprechen. Das erfordert Fingerspitzengefühl, ja. Es ist aber unvermeidbar, wenn Sie die Einzelgänger zurück ins Team integrieren wollen.
Sitzen Sie das Problem auf keinen Fall aus! Davon abgesehen, dass Chefs eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern haben, ist die Reintegration der beste Beweis für eine wertschätzende Unternehmenskultur und ein kollegiales Arbeitsklima, das diesen Namen verdient.
Was kann ich selber tun, um nicht mehr Außenseiter zu sein?
Einmal Outsider, immer Outsider? Quatsch! Es gibt durchaus Wege, wie Sie selber die Außenseiterrolle abstreifen können und sich mehr intergrieren. Unsere Tipps und Empfehlungen:
- Positionierung
Hinterfragen Sie Ihre Selbstpositionierung: Gefallen Sie sich womöglich in der Rolle des Kritikers oder Bedenkenträgers? Das könnte zugleich der Grund sein, warum andere den Kontakt zu Ihnen meiden. - Spielregeln
In jedem Team, in jeder Gemeinschaft gibt es heimliche Spielregeln. Diese Teamregeln verbinden und sind zugleich der Beweis, dass Sie die Bedeutung der Gruppe und Zugehörigkeit anerkennen bzw. über das eigene Wohlbefinden stellen – wie bei Initiationsriten. Halten Sie sich daran! - Kontaktpflege
Warten Sie nicht auf den weißen Reiter, der Sie rettet. Er kommt nie! Überwinden Sie stattdessen Ihren Stolz und suchen Sie aktiv den Kontakt zur Gruppe. Bringen Sie sich wieder mehr ein und ins Gespräch. Auch wenn Sie zunächst keine(r) fragt: Bieten Sie an, mitzumachen oder mitzukommen. - Vitamin B
Neben den Anführern gibt es in Teams auch die sogenannten heimlichen Spielführer – Menschen, denen andere besonders Vertrauen und die großes Ansehen genießen. Wer es schafft, eine Beziehung zu diesen Influencern aufzubauen, wird bald von ihnen protegiert und ist „drin“.
Psychologen sagen: Außenseiter kann jeder werden. Jeden kann es treffen – das ist nichts Persönliches, und persönlich nehmen sollten Sie das auch nie. Je unverkrampfter und gelassener Sie damit umgehen, desto eher bilden Sie Ihr eigenes Kollektiv. Popularität ist keine Identität!
Was andere dazu gelesen haben