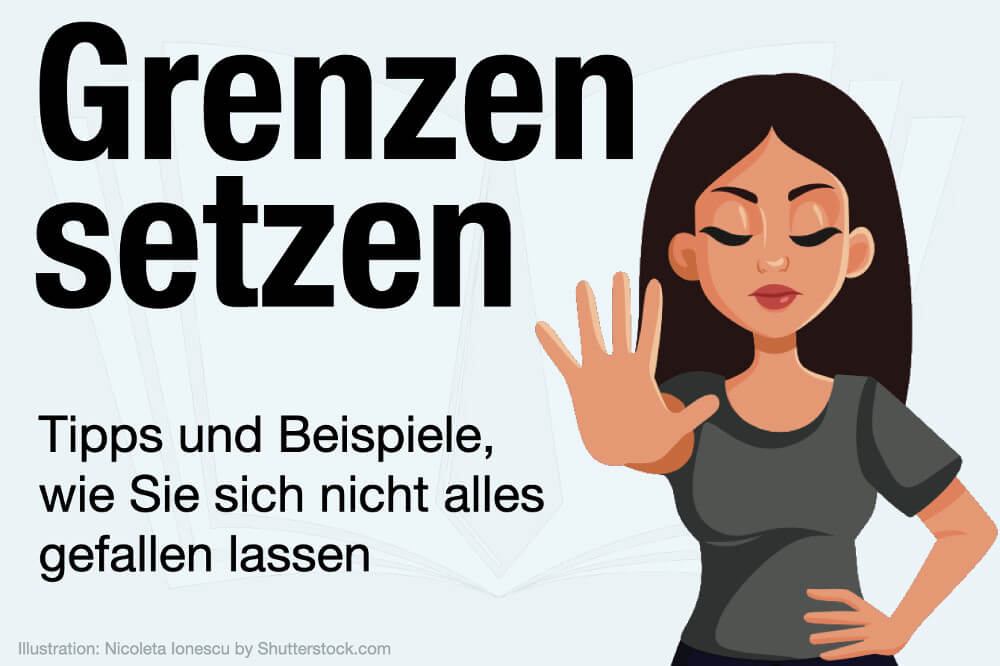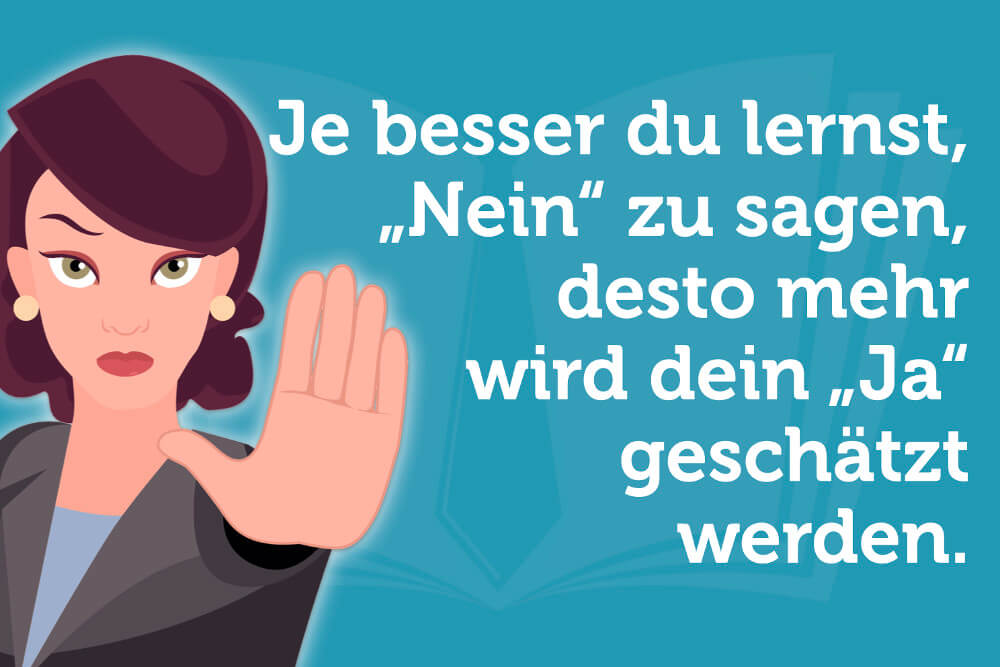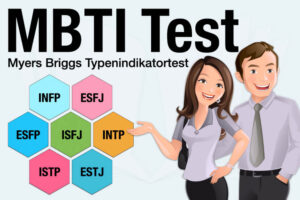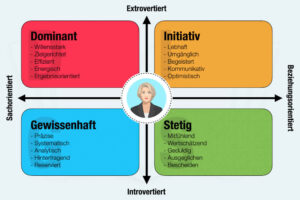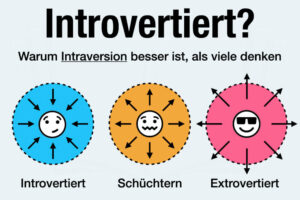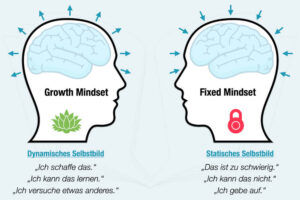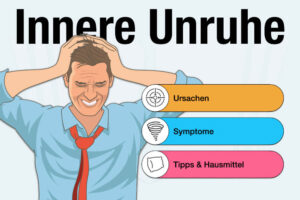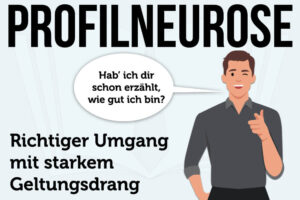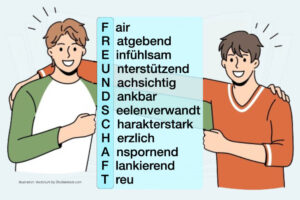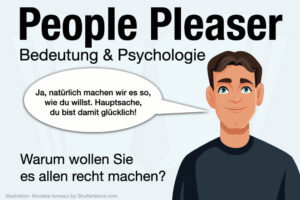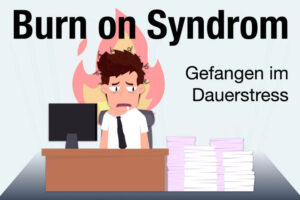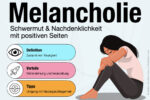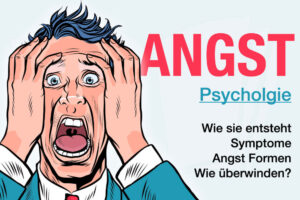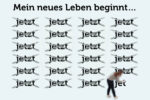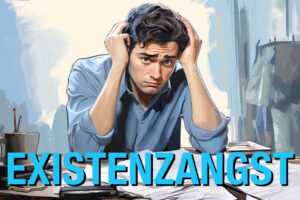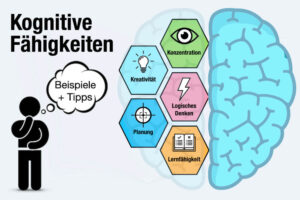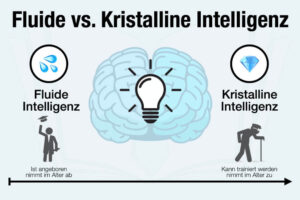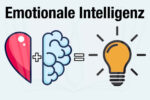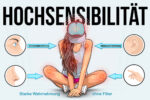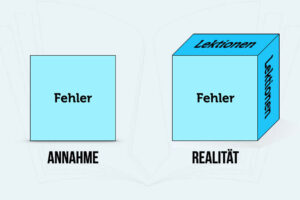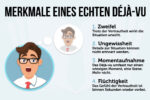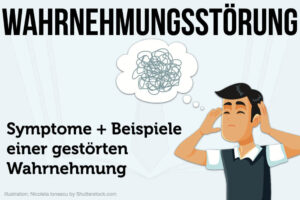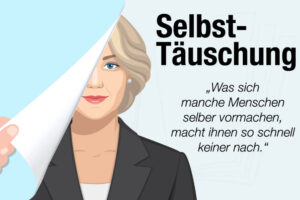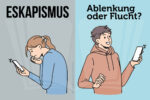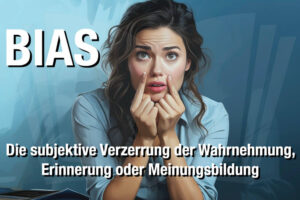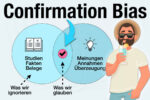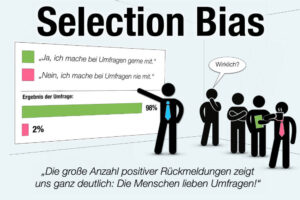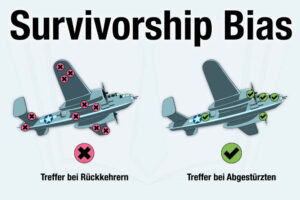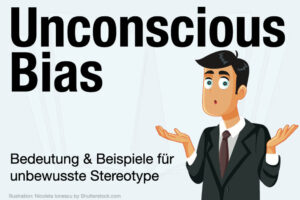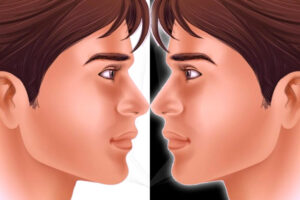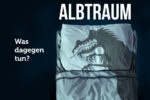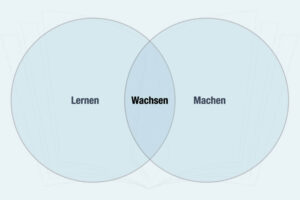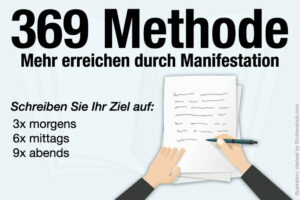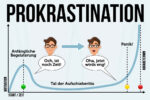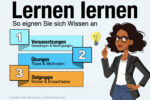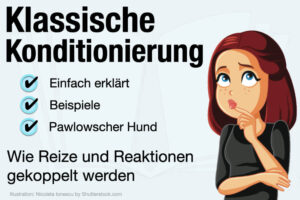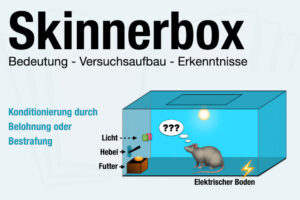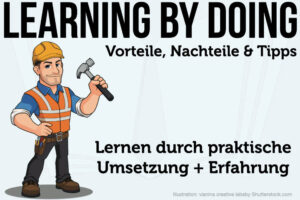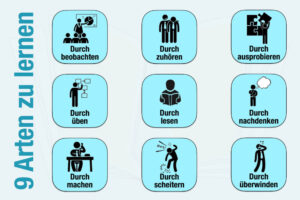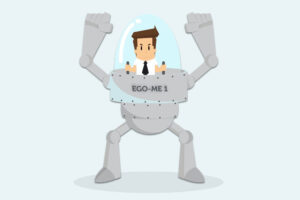Bedeutung: Was heißt Grenzen setzen?
Grenzen setzen bedeutet, dass Sie sich selbst und anderen gegenüber deutlich machen, wenn Ihnen etwas zu weit geht. Sie zeigen auf, bis zu welchem Punkt etwas in Ordnung ist – und was Sie nicht mehr wollen oder akzeptieren.
Ihre persönlichen Grenzen definieren, wer Sie sind, was Sie selbst tun und was Sie bei anderen tolerieren. Sie müssen diese nicht nur selbst kennen, sondern offen kommunizieren und diese auch einhalten. Grenzen können emotional, physisch, zeitlich oder moralisch sein – sind aber auch höchst individuell. Was den einen bereits vollkommen überfordert, ist für andere noch akzeptabel.
Grenzen setzen: Psychologie
Grenzen spielen auch in der Psychologie eine große Rolle. Sie sind Ausdruck der eigenen Bedürfnisse und zeigen, dass Sie sich selbst respektieren. Wer andere stets die eigenen Grenzen überschreiten lässt, leidet oftmals an geringem Selbstwertgefühl.
Klare Grenzen sagen: Ich kenne mich und stehe für meine Wünsche und Belange ein. Sie entscheiden selbstbewusst, welches Verhalten Sie akzeptieren und welches nicht.
Warum kann ich keine Grenzen setzen?
„Das will ich nicht und lasse es auch nicht zu.“ Ein scheinbar einfacher Satz, der jedoch nur selten gesagt wird. Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten, eigene Grenzen zu setzen und vor allem einzuhalten.
Wichtig ist auch hier die Psychologie. Es sind tiefe Emotionen und Gedanken, die uns vor Probleme stellen:
-
Angst vor Ablehnung
Wir fürchten uns vor Ablehnung und Zurückweisung. Wenn wir für uns einstehen, stoßen wir andere möglicherweise vor den Kopf.
-
Frühkindliche Prägung
Lernen Kinder bereits in jungen Jahren, dass ihre Grenzen nicht gehört und beachtet werden, fällt es ihnen im späteren Leben schwer, diese zu setzen.
-
Falsche Schuldgefühle
Ein häufiger Gedanke: „Wenn ich Nein sage, bin ich egoistisch oder verletze die andere Person.“ Sie haben zu Unrecht Schuldgefühle, wenn Sie Grenzen setzen und einhalten.
-
Keine Selbstreflexion
Leider wissen viele Menschen gar nicht, was die eigenen Bedürfnisse sind. Es fehlt an Selbstreflexion und Klarheit über die eigenen Wünsche.
Darum müssen Sie Grenzen setzen und einhalten
Setzen Sie Grenzen und halten andere diese auch ein? Wenn nicht, sollten Sie unbedingt damit anfangen. Die eigenen Bedürfnisse sowie Grenzen zu kennen und dafür einzustehen, bringt zahlreiche Vorteile:
-
Sie schützen sich vor Überforderung
Überschrittene Grenzen führen schnell zu Überforderung. Sie sind mit Ihrer Kraft am Ende, haben längst keine Kapazitäten mehr und machen doch immer weiter. Das zeigt sich besonders häufig im Job, wenn der Chef ständig neue und mehr Aufgaben verteilt – und Sie alles hinnehmen.
-
Sie verhindern Manipulation
Wer ständig tut, was andere sagen, wird leicht Opfer von Manipulation. Andere nutzen die Schwäche in Ihrem Verhalten aus, um Vorteile daraus zu ziehen. Sie lassen sich dazu bringen, Dinge zu tun, die Sie eigentlich nicht wollen.
-
Sie entwickeln größere Selbstsicherheit
Mit persönlichen Grenzen wissen Sie genau, was Sie wollen, was Sie akzeptieren und an welchem Punkt für Sie Schluss ist. Das gibt Ihnen eine größere Selbstsicherheit, in jeder Situation ruhig und souverän zu reagieren.
-
Sie haben klare Prioritäten
Grenzen sind Ausdruck Ihrer Prioritäten. Auf welche Bereiche wollen Sie sich konzentrieren? Wo wollen Sie weniger Zeit und Energie investieren? Mit diesem Wissen treffen Sie für sich bessere Entscheidungen.
-
Sie schützen Ihre psychische Gesundheit
Durch klare Grenzen schützen Sie Ihre psychische Gesundheit. Es ist emotional und mental ungemein belastend, es ständig allen anderen recht machen zu wollen (siehe: People Pleaser). Sie müssen eigene Ansichten, Standpunkte und Bedürfnisse verleugnen. Das kann auf Dauer zu ernsten psychischen Problemen führen. In schlimmen Fällen drohen Burnout oder Depressionen.
Formulierungen: So setzen Sie richtig Grenzen
Die kürzeste Formulierung für Grenzen ist ein kurzes und klares „Nein“. Sie beziehen damit Ihren Standpunkt und zeigen, was für Sie nicht geht.
In der Praxis braucht es meist etwas längere Formulierungen. Wenn Sie nicht wissen, was Sie sagen sollen, können diese Beispiele weiterhelfen und inspirieren:
- „Ich brauche jeden Tag eine Stunde Zeit für mich.“
- „Ich akzeptiere nicht, dass du mich anschreist, wenn du wütend wirst.“
- „Ich möchte nicht, dass du meine Nachrichten liest.“
- „Wenn ich mich gerade nicht wohl fühle, möchte ich nicht geküsst oder angefasst werden.“
- „Ich will nicht, dass du meine Gefühle kleinredest.“
- „Du darfst nicht schlagen, schubsen oder beißen – auch nicht, wenn du wütend bist.“
- „Einen solchen Ton mir gegenüber werde ich nicht akzeptieren.“
- „Das ist so nicht möglich. Wenn du einen anderen Vorschlag hast, höre ich ihn mir gerne an.“
- „Dein Benehmen ist respektlos und ich werde mich nicht darauf einlassen.“
- „Du darfst deine Freizeit selbst einteilen, aber deine Hausaufgaben müssen erledigt sein.“
- „Das geht dich wirklich nichts an und ich möchte nicht, dass du weiter nachfragst.“
- „Dieses Verhalten passt nicht zu meinen Werten.“
- „Ich mag keine unangekündigten Besuche. Bitte sag mir vorher Bescheid.“
- „Die Erziehung meiner Kinder entscheide ich alleine.“
- „Über dieses Thema möchte ich nicht sprechen.“
- „Außerhalb der Arbeitszeit schaue ich nicht in berufliche Nachrichten.“
- „Dafür habe ich absolut keine Zeit mehr.“
- „Ich bin jederzeit für professionelle Kommunikation offen – solch unsachliche Diskussionen führe ich aber nicht.“
- „Über solch ein privates Thema möchte ich nicht mit Ihnen sprechen.“
- „Diese Woche schaffe ich das auf keinen Fall. Frühestens nächste Woche könnte ich mich darum kümmern.“
Grenzen setzen in der Beziehung
In einer Beziehung geht es um Liebe, Zuneigung und gemeinsame Zeit. Trotzdem braucht es auch hier Grenzen, um persönliche Bedürfnisse zu wahren und eigene Freiräume zu schützen.
Grenzen setzen bei Kindern
Grenzen setzen in der Familie
Grenzen setzen bei der Arbeit
Grenzen setzen: 6 Tipps
„Du musst auch mal Grenzen setzen…“ – Solch gut gemeinte Ratschläge von Freunden oder Familie bringen letztlich wenig. Wenn es so einfach wäre, würden Sie es schließlich tun.
Damit Sie in Zukunft eindeutige Grenzen vorgeben, die andere (und Sie selbst) auch einhalten, helfen diese sechs Tipps:
-
Finden Sie Ihre persönlichen Grenzen
Zu Beginn müssen Sie Ihre individuellen Grenzen definieren. Bis zu welchem Punkt fühlen Sie sich wohl? Welche Art von Verhalten wollen Sie nicht tolerieren? Wie viel Zeit, Kraft und Energie steht zur Verfügung? Durch gründliche Selbstreflexion in verschiedenen Situationen finden Sie heraus, wo Ihre Grenzen liegen.
-
Haben Sie keine Angst vor der Reaktion
Wenn Sie Grenzen aufzeigen, kann es zu Konflikten kommen. Haben Sie keine Angst davor. Denken Sie daran: Es ist besser, einen Streit oder Ablehnung zu riskieren, als dauerhaft die eigenen Grenzen zu ignorieren und Bedürfnisse zu verleugnen.
-
Machen Sie eindeutige Ansagen
In der Kommunikation Ihrer Grenzen müssen Sie eindeutig sein. Machen Sie keine schwammigen Aussagen und suchen Sie keine Ausflüchte. Ein Nein ist eine klare Ansage und sollte auch so rübergebracht werden.
-
Achten Sie auf die Einhaltung
Reden allein reicht nicht aus. Andere müssen Ihre Grenzen tatsächlich einhalten und respektieren. Sollte jemand sich nicht daran halten, betonen Sie diese noch einmal. Hilft auch das nicht, müssen Sie andere Konsequenzen für das Verhalten finden.
-
Setzen Sie immer wieder Grenzen
Auch für Grenzen gilt: Übung macht den Meister. Anfangs mag es besonders schwierig sein, deshalb müssen Sie regelmäßig daran arbeiten. Im Job, bei Freunden, in der Familie – setzen Sie in jedem Bereich des Lebens klare Grenzen.
-
Trennen Sie sich von Grenzüberschreitern
Manche Menschen sind leider unbelehrbar. Sie überschreiten ständig die Grenzen anderer und lassen sich nicht davon abbringen. Hier hilft meist nur noch, den Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren. Meiden Sie solche Kollegen oder beenden Sie (falls nötig) bestehende Freundschaften. Kein leichter Schritt, doch langfristig ist es besser für Sie.
Grenzen setzen mit dem INGA-Prinzip
Ein einfacher Weg, bessere Grenzen zu setzen, ist das INGA-Prinzip. Hier können Sie sich gemäß der Anfangsbuchstaben vier einfache Reaktionen merken:
-
Interesse zeigen
Anfangs hören Sie aufmerksam zu. Egal, welches Anliegen geäußert oder welche Frage gestellt wird: Nehmen Sie diese zunächst ernst und zeigen Sie Interesse.
-
Nein sagen
Antworten Sie bestimmt und unmissverständlich mit „Nein“. Dabei sollten Sie stets freundlich und respektvoll sein, aber klarmachen, dass Sie nicht machen werden, was verlangt ist.
-
Grund nennen
Sie schulden niemandem eine Rechtfertigung. Eine kurze Begründung erhöht aber das Verständnis bei Ihrem Gegenüber. Außerdem verhindern Sie Spekulationen über Ihre Beweggründe.
-
Alternative bieten
Als Letztes bieten Sie eine Alternative, die nicht Ihre Grenzen überschreitet. Beispiel „Das werde ich so nicht machen. Ich könnte aber stattdessen…“
Was andere dazu gelesen haben