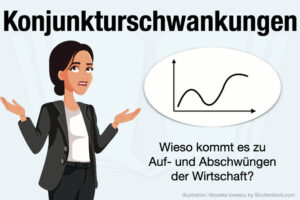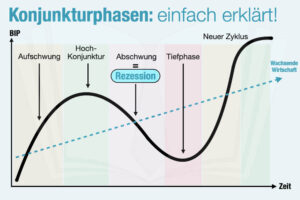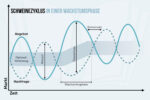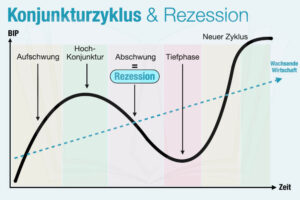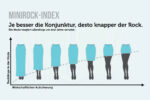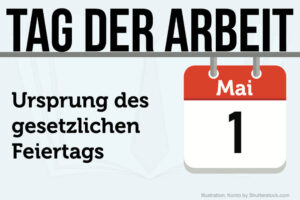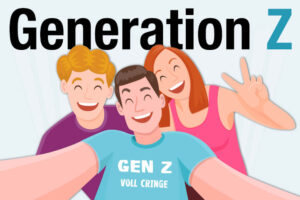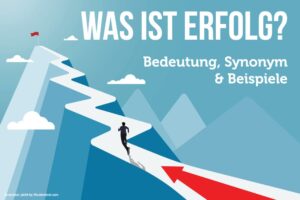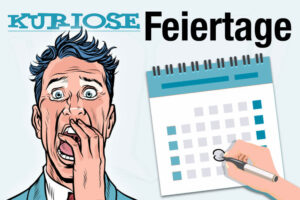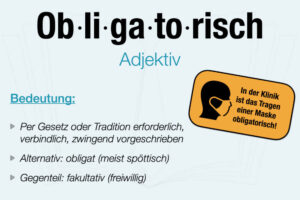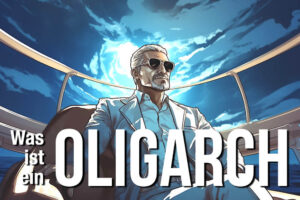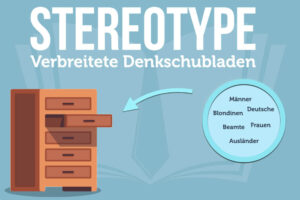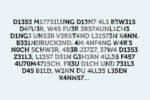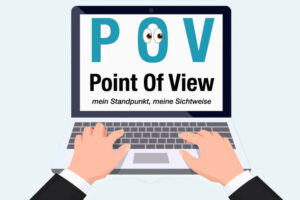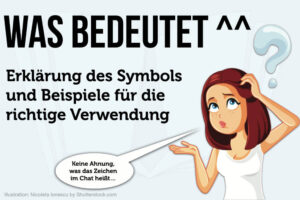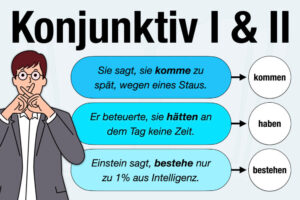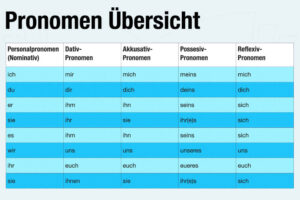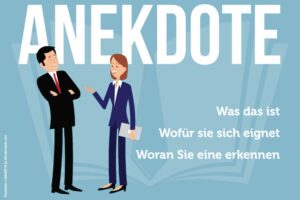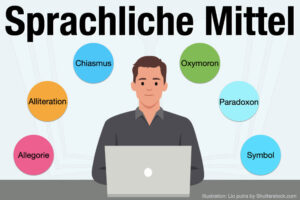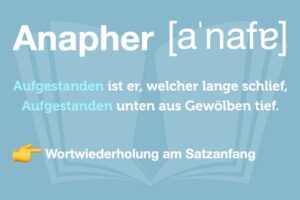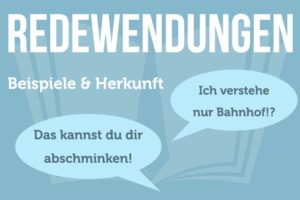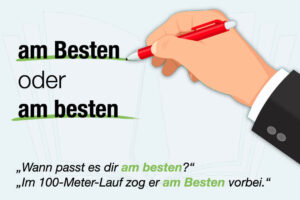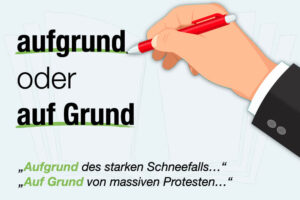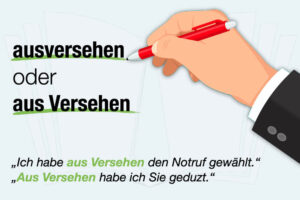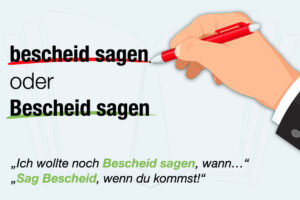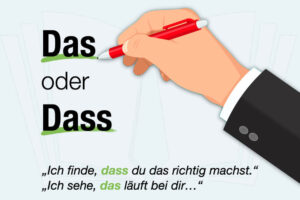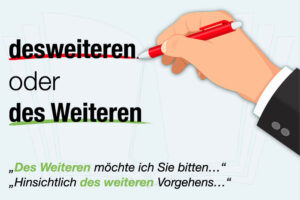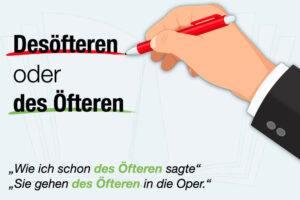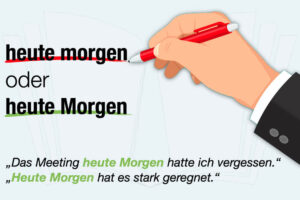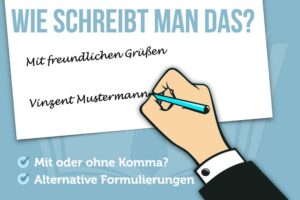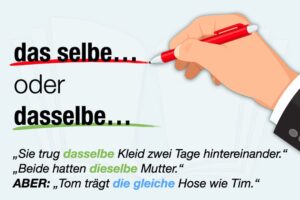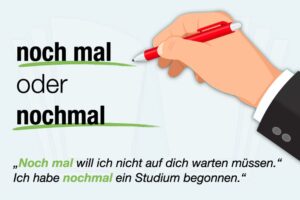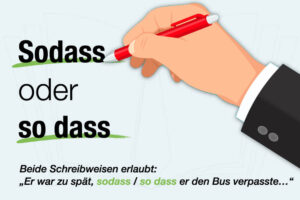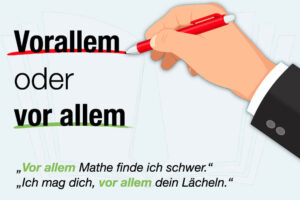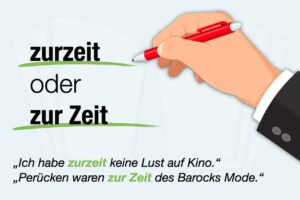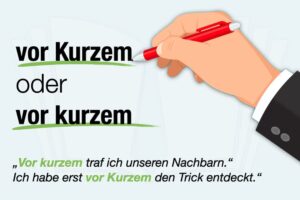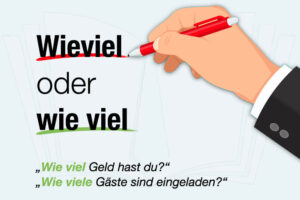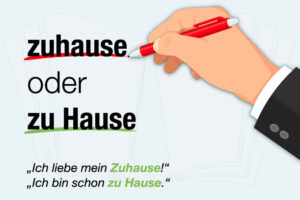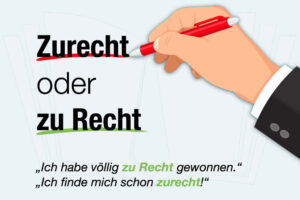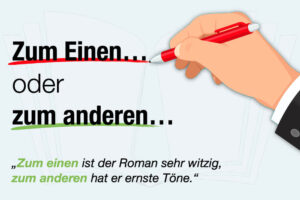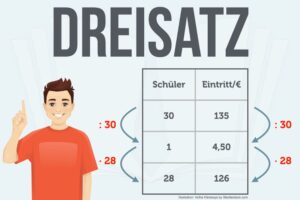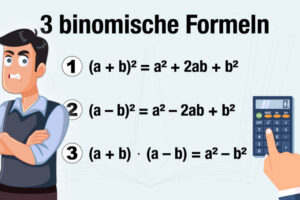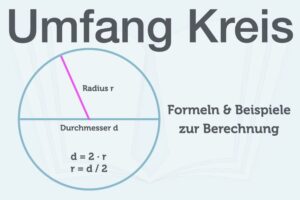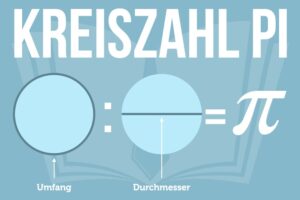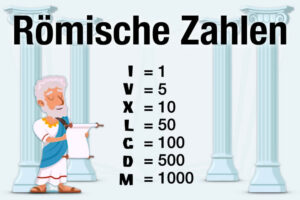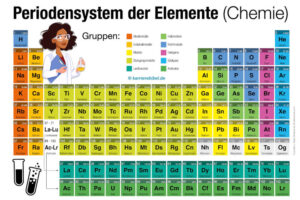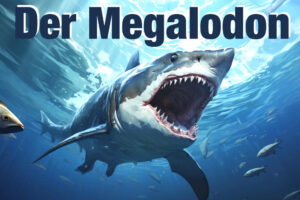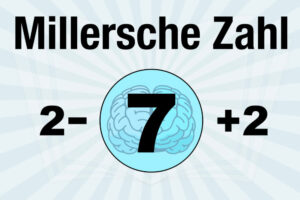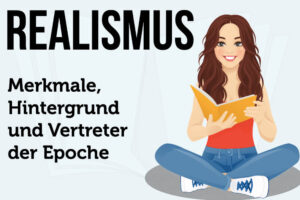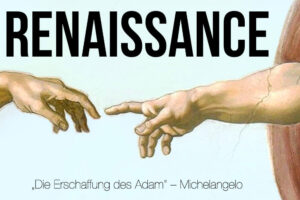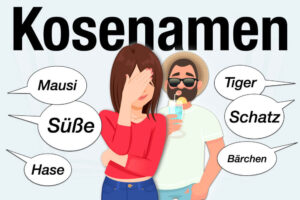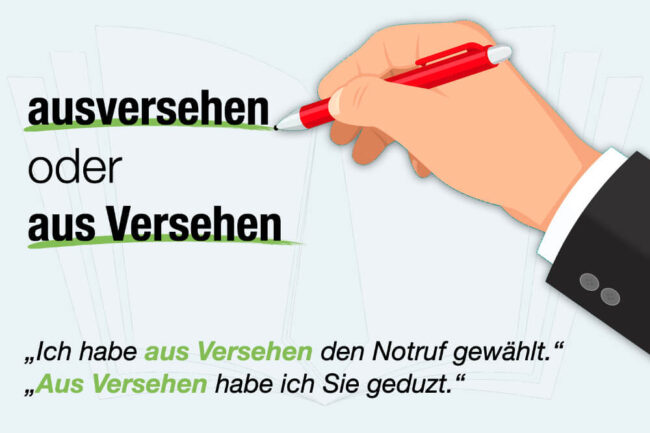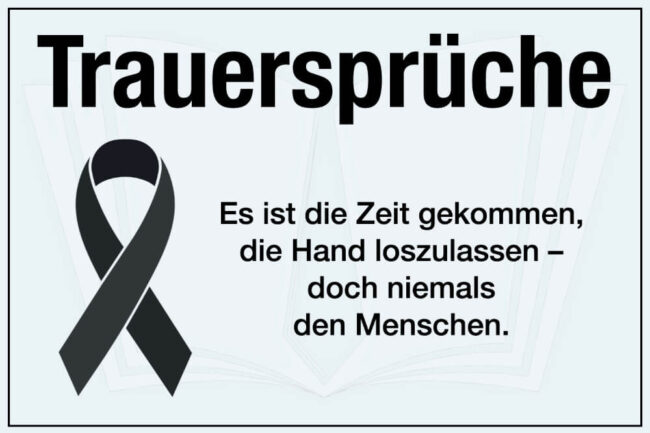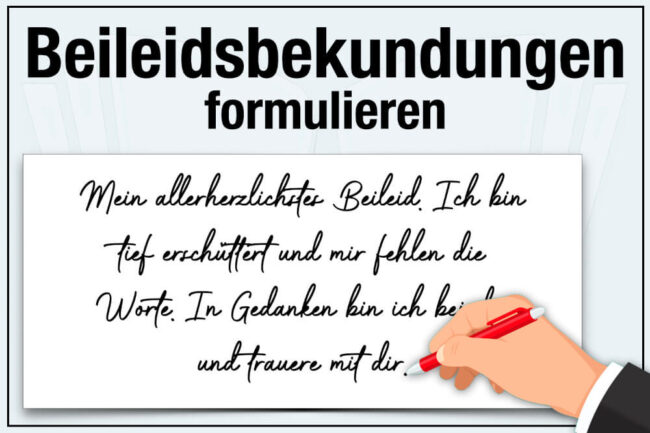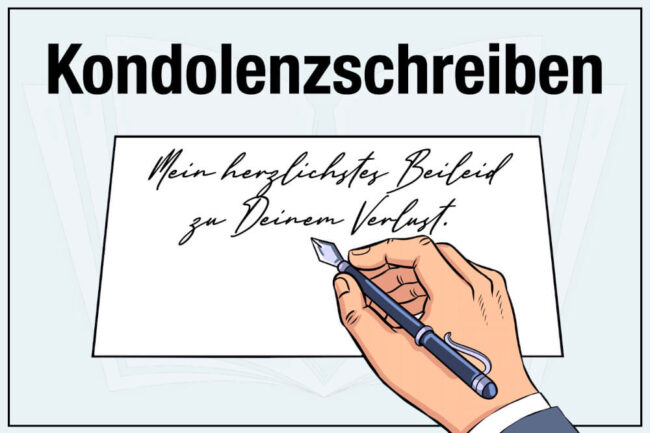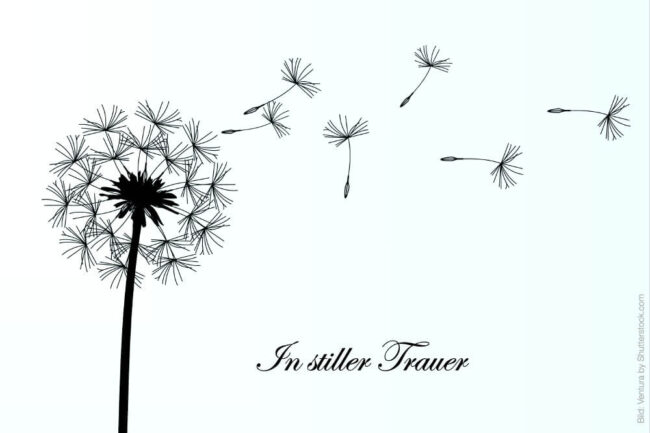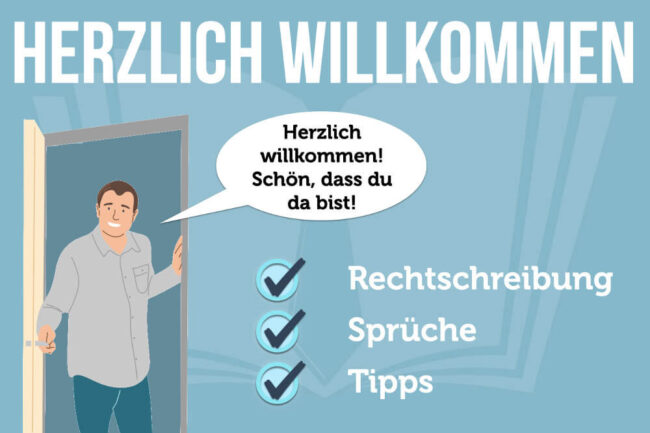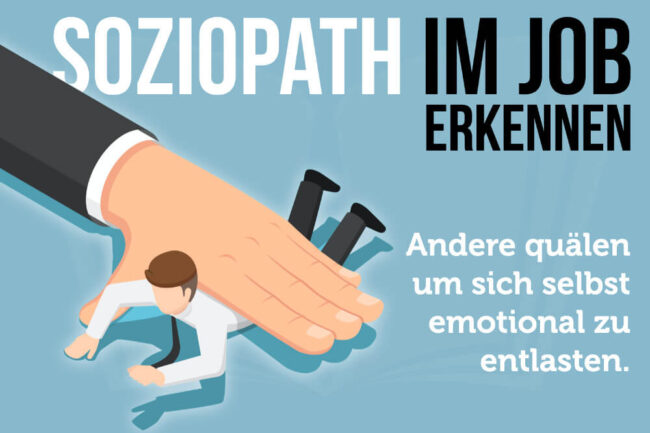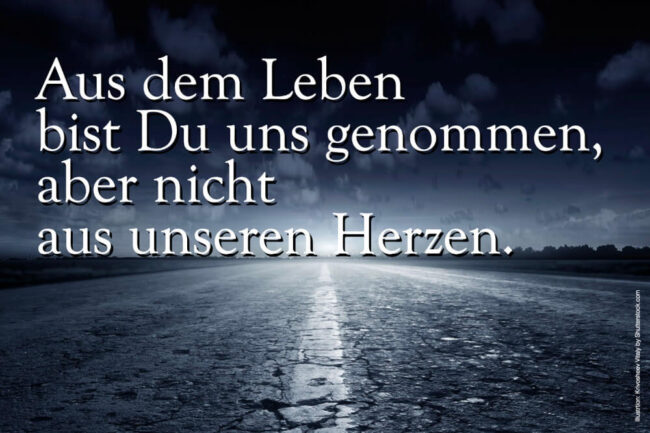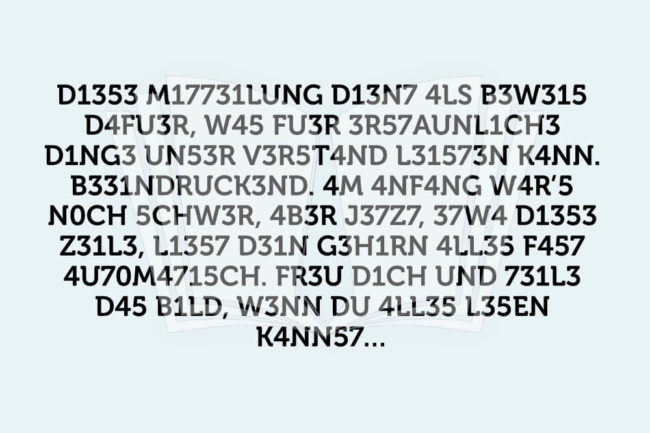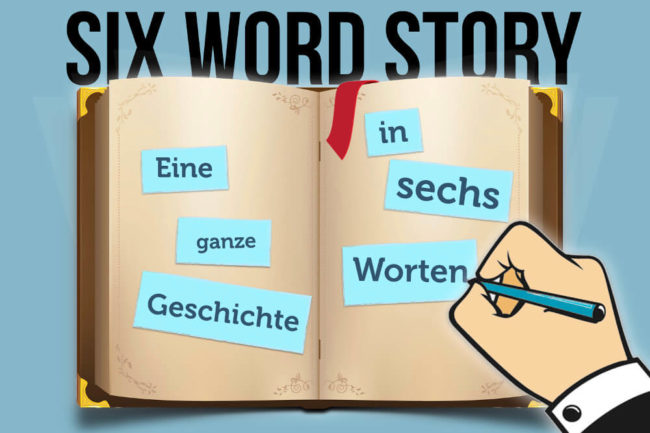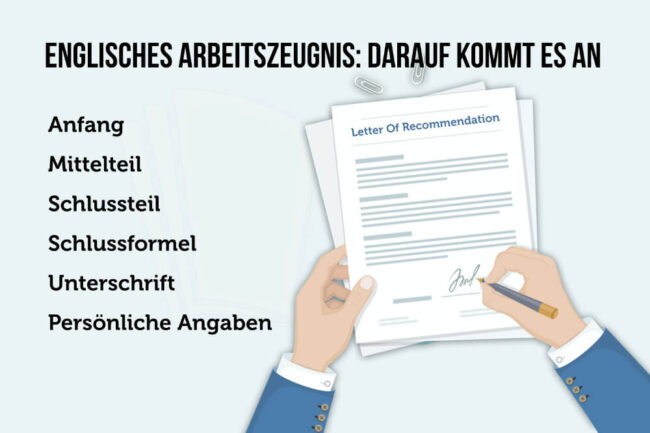Anglizismus Definition: Was sind Anglizismen?
Anglizismen sind Ausdrücke, die aus der englischen Sprache entnommen und in den deutschen Sprachgebrauch und Alltag übernommen wurden. Viele davon haben sich im Alltag, in der Jugendsprache und Fachsprache etabliert.
Anglizismen werden teils nach ihrer Herkunft differenziert: Stammen sie aus dem britischen Englisch, spricht man von „Britizismen“ – von „Amerikanismen“ bei US-Herkunft und von „Australizismen“ bei australischem Englisch. Die Bezeichnung „Anglizismus“ wiederum beschreibt generell, dass der Ausdruck aus der englischen Sprache stammt (lat. anglicus = englisch).
Anglizismen in der deutschen Sprache
Laut einer Studie der Universität Bamberg haben sich die Anglizismen im deutschen Sprachraum in den vergangenen 10 Jahren mehr als verdoppelt. Begriffe und Beispiele wie „Baby“, „Jeans“ oder „Rock“ (Musik) gibt es zwar schon lange im Deutschen, doch sind in jüngster Zeit zahlreiche Begriffe aus der IT sowie neue Berufsbezeichnungen (siehe: Jobtitel) hinzugekommen.
Beispiele für neue Berufsbezeichnungen:
- Hausmeister ➠ Facility Manager
- Berater ➠ Consultant
- Werbegestalter ➠ Art Director
- Kundenbetreuer ➠ Customer Relationship Manager
- Großkundenbetreuer ➠ Key Account Manager
- Vorstand ➠ CEO (Chief Operating Officer)
Vor allem in der Wirtschaft – speziell im Marketing, Vertrieb sowie in der IT – bürgern sich immer mehr englische Ausdrücke ein, die ihren Ursprung im Internet und in den neuen Medien („Social Media“) haben. Allerdings ist das Ausmaß der Anglizismen und Übernahmen abhängig von der jeweiligen Generation und den gesellschaftlichen Gruppen.
Sind Anglizismen Jugendsprache?
Englische Wörter sind keinesfalls ein Privileg der Jugendsprache. Zwar nutzen junge Menschen besonders häufig Anglizismen (Beispiele: „lost“, „nice“, „woke“, „gamechanger“, „cringe“ – Jugendwort des Jahres 2021). Die Adjektive und Begriffe finden sich in ihrem Sprachgebrauch aber nicht signifikant häufiger als im Geschäftsleben.
Anglizismen Beispiele im Alltag
Die meisten Anglizismen im Alltag verwenden wir unbewusst. Die englischen Wörter und Begriffe sind schon viele Jahre Teil der deutschen Umgangssprache oder gar Amtssprache, und wir nehmen sie nicht mehr als fremd wahr. Hin und wieder führt das zu ulkigen Sätzen wie dem legendären Spruch von Andy Möller: „Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl.“ Teils gibt es für diese Anglizismen aber auch keine deutschen Alternativen. Zum Beispiel Training, Aerobic, Joggen, Internet oder Quiz.
Zudem gibt es (d)englische Redewendungen, bei denen niemandem mehr auffällt, dass sie im Deutschen falsch sind. Bestes Beispiel: „Sinn machen“ (englisch: „make sense“). In der deutschen Sprache gibt es allein „Sinn haben“ oder „sinnvoll sein“ – der Anglizismus macht keinen Sinn.
Liste mit Anglizismen im Alltag
Zu den Anglizismen, die uns im Alltag kaum noch als solche auffallen, weil sie Teil im allgemeinen Sprachgebrauch sind, gehören: Actionfilm, Band (Musikgruppe), Bar, Blog, Clown, Cockpit, Countdown, Festival, Gangster, Interview, Jetlag, Ketchup, Laser, Logo, Minijob, Monster, Okay, PC (Personal Computer), Puzzle, Rapper, Sandwich, Slum, Stewardess, Surfer, Toastbrot, Trend, T-Shirt, Yuppie oder Zoom.
Eine ausführliche Liste zahlreicher Alltags-Anglizismen finden Sie am Ende des Artikels – samt Bedeutung und Übersetzung.
Anglizismen in der Fachsprache
Auch und gerade in der Fachsprache werden viele englische Ausdrücke genutzt. Das liegt nicht zuletzt an der Globalisierung und daran, dass Englisch DIE internationale Verkehrssprache („lingua franca“) im Business ist.
Die meisten internationalen Fachtexte und Studien werden auf Englisch publiziert – und von dort dann auch gleich übernommen. Viele (gehobene) Anglizismen stammen daher aus den Bereichen Wissenschaft, Internet und Technik. Im folgenden finden Sie zwei Listen besonders häufiger englischer Fachausdrücke – allgemein und im Job:
Die 12 häufigsten Anglizismen in…
FachspracheApp |
Berufsalltag*1. Meeting |
Anglizismen Arten und Beispiele
In der deutschen Sprache kommen verschiedene Arten von Anglizismen zum Einsatz. Betroffen sind nicht nur einzelne Wörter, sondern auch untypische Satzstellungen oder abweichende Bedeutungen. Die verschiedenen Anglizismus Arten im Überblick:
-
Wortebene (Lexik)
Bei sogenannten „Wortentlehnungen“ wird der englische Begriff 1:1 übernommen, Beispiele: Browser, Hashtag, Fan, Start-up.
-
Satzebene (Syntax)
Bei der „Formenbildung“ wird das englische Wort eingedeutscht und etwa zum Verb (konjugiert), Beispiel: mit einem Problem struggeln oder etwas downloaden. Das betrifft teils auch englische Markennamen: Ganz selbstverständlich googeln, zoomen oder whatsappen wir heute.
-
Inhaltsebene (Semantik)
Bei „Lehnübersetzungen“ wird die Bedeutung eines englischen Begriffs wortgetreu und Wort für Wort übernommen, Beispiele: brand new= brandneu; Gehirnwäsche = Brainwashing. Eine „Lehnübertragung“ übersetzt nicht wörtlich, sondern sinngemäß, Beispiele: airlift = Luftbrücke; Wolkenkratzer = Skyscraper.
-
Lautebene (Phonetik)
Die deutsche Aussprache orientiert sich an der englischen, Beispiel: Die Informationstechnik, kurz: IT wird wie „ei ti“ ausgesprochen.
Anglizismen Wirkung der Formen
In der Sprachwissenschaft werden nicht nur die Anglizismen Arten, sondern auch verschiedene Formen unterschieden, die zudem unterschiedliche Auswirkungen haben. Generell werden hierbei vor allem drei Anglizismen Wirkungen unterschieden:
1. Ergänzende Anglizismen
Sie machen mit nur 3 Prozent den kleinsten Teil der Wirkungen aus. Ergänzende Anglizismen füllen Lücken in der deutschen Sprache, wenn neue Produkte, Ideen oder Berufe entstehen und es dafür kein passendes deutsches Wort gibt. Diese Anglizismus bereichern also die deutsche Sprache mit neuen Begriffen und Wortkreationen.
Beispiele: Admin, Babysitter, Bowling, Dimmer, Disco, Festival, Monster
2. Differenzierende Anglizismen
Hierunter fallen englische Ausdrücke, die wir im Alltag meist synonym zu deutschen Wörtern nutzen oder existierende Begriffe damit ergänzen beziehungsweise genauer umschreiben. Der Anteil diese Anglizismen beträgt rund 18 Prozent, viele davon finden sich in der Fachsprache.
Beispiele: Action, Bachelor, Burnout, Brainstorming, Teamwork, Permalink
3. Verdrängende Anglizismen
Rund 79 Prozent aller Anglizismen in der deutschen Sprache zählen hierzu – und ärgern vor allem die Sprachpuristen in Deutschland. Denn sie ergänzen und erweitern nichts, sondern verdrängen schlicht schöne deutsche Wörter und Sprachklassiker – oft nur, weil es damit moderner und „hipper“ klingt.
Beispiele: Access (statt: Zugriff), Apartment (statt: Wohnung), Blockbuster (statt: Kassenschlager), Briefing (statt: Einweisung), Deadline (statt: Fristende), Homeschooling (statt: Heimunterricht), Sabbatical (statt: Auszeit), Wallpaper (statt: Bildschirmhintergrund)

Anglizismen: Pro & Contra
Anglizismen polarisieren, an ihnen scheiden sich viele Geister. Oft wird hitzig über die Vor- und Nachteile diskutiert. Manche sprechen vom „Sprachverfall“ – andere sehen in dem deutschen Sprachwandel eine fortschrittliche Bereicherung, die sich ohnehin nicht verhindern lässt. Ohne, dass wir uns auf eine Seite schlagen, finden Sie im Folgenden alle wichtigen Pro und Contra Argumente im Überblick:
Contra Argumente – Gegen Anglizismen spricht…
- Anglizismen und Denglisch sind Ausdruck von Denkfaulheit, weil es dafür oft gute deutsche Wörter gibt.
- Vor allem verdrängende Anglizismen sind eine Bedrohung der deutschen Sprache als wichtiges Kulturgut.
- Für einen verständlichen Ausdruck und eine ästhetische Sprache braucht es kein Denglisch oder Germisch.
- Insbesondere Scheinanglizismen sind ein Hinweis auf unzureichende Englischkenntnisse in der breiten Bevölkerung.
- Anglizismen führen zu Missverständnissen, Jung und Alt verstehen sich nicht mehr und die Orthografie leidet zusätzlich darunter.
Pro Argumente – Für Anglizismen spricht…
- Ergänzende und differenzierende Anglizismen bereichern unseren Wortschatz.
- Für moderne Erfindungen oder Innovationen gibt es kein passendes deutsches Wort.
- Sprache lebt – sie wird durch Wortneuschöpfungen und Anglizismen lebendiger und kreativer.
- Der Sprachverfall ist ungefährlich, weil der Anteil von englischen Begriffen sehr gering ist.
- Statt schwierige Bedeutungen lange zu umschreiben, bringen es englische Wörter oft auf den Punkt: Event statt Veranstaltung.
- Etablierte Anglizismen erhöhen das internationale Verständnis und sorgen für einen Kulturaustausch – schließlich gibt es im Angelsächsischen auch deutsche Lehnwörter: Angst, Kindergarden, Rucksack oder das „Leitmotif“ – sog. Germanismen.
- Die internationale Kommunikation findet ohnehin schon auf Englisch statt.
Anglizismen sind Teil des Sprachwandels – ob man Sie gut findet oder nicht. Verhindern lassen sie sich nicht, Sprache verändert sich permanent. Aufpassen sollten wir jedoch bei sogenannten „false friends“ – englisch klingende Wörter, die im Englischen aber anderes bedeuten. Beispiel: Der „Beamer“ heißt auf Englisch „Projector“; die „Hotline“ wird im Angelsächsischen „Helpline“ genannt und der „Chef“ ist im Englischen leider nur der Koch – die korrekte Übersetzung wäre: Boss.
Häufige Fragen zum Thema Anglizismen
Was ist der Unterschied zwischen Anglizismen und Denglisch?
Anglizismen sind Wörter oder Ausdrücke, die aus dem Englischen ins Deutsche übernommen werden und Teil der deutschen Sprache werden. Denglisch hingegen bezeichnet die übertriebene Verwendung englischer Phrasen in einem Satz. Beispiel: „Lass uns die Erwartungen im Call heute challengen und uns auf einen narrativen Approach committen.“ Hä?
Wie viele Anglizismen gibt es in der deutschen Sprache?
Nach Meinung von Sprachschützern: zu viele. Dabei enthält die deutsche Sprache zahlreiche Lehnwörter. Beispiele: Friseur (Französisch) oder Kiosk (Türkisch). Die genaue Anzahl der Anglizismen lässt sich schwer ermitteln, manche zählen dazu die englischen Begriffe im Duden. Danach wären es aktuell knapp 4 Prozent. Der tatsächliche Anteil dürfte aber höher liegen, weil es längst nicht jedes moderne Wort in den Duden schafft.
Woran kann ich Anglizismen erkennen?
Verräterisch für Anglizismen sind immer ungewöhnliche Buchstabenfolgen. Im Deutschen gibt es nur bestimmte Abfolgen von Vokalen und Umlauten. Eine Kombinationen mit ea, ui, ou, oo sowie Wortendungen auf y (Baby, Hobby, City, Spray) zeigen oft einen Anglizismus an. Weiteres Erkennungsmerkmal: Die Aussprache weicht vom Schriftbild ab. Beispiel: Management müsste „Männätschment“ geschrieben werden.
Woher kommt die Begeisterung für das Englische?
Die Begeisterung für das Englische im Deutschen beginnt nicht etwa erst nach dem 2. Weltkrieg und mit den in Deutschland stationierten Alliierten. Schon Goethe pries Shakespeare. Im 18. und 19. Jahrhundert war England der Inbegriff für Aufklärung, Fortschritt und Industrialisierung. Ein englischer „Way of Life“ mit Teekonsum und Gartenbaukunst ist bis heute im Hanseatischen Raum erhalten geblieben: Hamburg gilt als „englischste Stadt auf dem Festland“ – immerhin wurden dort die Beatles entdeckt!
Ausführliche Liste mit Anglizismen von A-Z
Zum Abschluss finden Sie hier eine ausführliche Liste zahlreicher englischer Ausdrücke, die es es schon in die deutsche Sprache geschafft haben. Und – ehrlicherweise – handelt es sich dabei um Anglizismen, die wir selber nutzen. Daher sind die entsprechenden „Keywords“ und Artikel gleich dazu verlinkt – als praktische Erklärung und Übersetzung.
Was andere dazu gelesen haben